Prüfen mit KI: Zwischen Cheaten und Chance
Angela Schröder und Andreas Giesbert arbeiten intensiv mit KI-Tools. Zuletzt plädierten sie beim Symposium „Prüfen trotz und mit KI“ für einen proaktiven und kritischen Umgang.
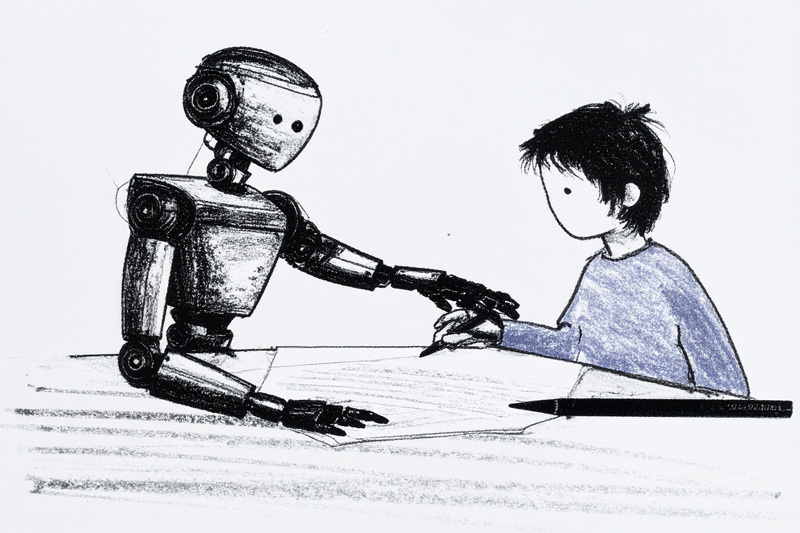 Foto: Adobe Firefly/Prompt: FernUniversität
Foto: Adobe Firefly/Prompt: FernUniversität
Schummeln Studierende oder Forschende, wenn sie KI nutzen? „Das ist eine problematische Perspektive – auch, weil wir uns ja in Zukunft gestalterisch mit KI befassen wollen“, ordnet Dr. Angela Schröder vom Schreibzentrum der FernUniversität ein. Statt die neuen Tools kategorisch zu verdammen, müsse ein konstruktiver Umgang mit ihnen etabliert werden. „Es geht nicht darum, immer nur zu verhindern, sondern im Rahmen wissenschaftlicher Standards zu ermöglichen.“ Eine Sichtweise, die die akademische Landschaft spaltet, so die Medienwissenschaftlerin. „Es gibt die Konservativen, die bewahren möchten, und diejenigen, die Studierende wie Lehrende anleiten, begleiten und professionalisieren wollen.“ Gerade an Universitäten müsse der reflektierte Umgang mit KI-Tools vermittelt werden, findet Schröder. „Es muss uns gelingen, den Studierenden Sinn und Funktion etwa von Zitation oder Recherche und Lesen zu vermitteln, die klassische wissenschaftliche Methodenlehre also. So befähigen wir sie, relevante KI-Tools zur Unterstützung auszuwählen.“
In Bezug auf Forschende ist es ihrer Meinung gar „der Auftrag von Universitäten, ihnen KI zugänglich zu machen. Denn darin liegt ein enormer Schub für die Forschungsleistung.“ So sei es zum Beispiel mittels KI-Tools ein Leichtes, auf der ganzen Welt Paper zusammensuchen zu lassen. „Besser als es manuell jemals möglich war“, betont die Expertin aus dem Zentrum für Lernen und Innovation (ZLI).
 Foto: FernUniversität
Foto: FernUniversität
Goldene Mitte finden
Auch Andreas Giesbert, Fachmediendidaktiker an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften, hat eine neugierige Haltung gegenüber den technischen Möglichkeiten von KI. Trotzdem sieht er für den Lehrbetrieb derzeit noch klare Grenzen: „Der Laden muss laufen“, zeigt sich er mit Blick auf seine Fakultät pragmatisch. Die akademische Lehre auf einen Schlag umkrempeln – das funktioniere nicht per Knopfdruck. „Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, in denen KI-Nutzung aus didaktischen Gründen ausgeschlossen werden sollte.“ Als Beispiel nennt er Einführungsmodule, in denen es am Ende eben auch um das Abfragen von grundlegendem Wissen geht. Eine Chatbot, der alle Antworten stumpf vorsagt, stände dem Lernen und der Lernkontrolle an dieser Stelle im Weg. „An unserer Fakultät setzen wir bei solchen Formaten deshalb auch auf bewusstes und dosiertes Proctoring.“ Die Online-Klausuren werden in diesen Fällen digital beaufsichtigt, um die Nutzung von Hilfsmitteln einschränken zu können.
 Foto: Hardy Welsch
Foto: Hardy Welsch
„Im besten Fall gehen einige der Studierenden nach ihrem Studium in die Forschung – auch dafür brauchen sie das entsprechende KI-Rüstzeug.“
Dr. Angela Schröder, Schreibzentrum
Verschiedene Komplexitätsgrade
Der technische Aufwand lohnt sich, findet Giesbert. Denn auch Prüfungen mit niedriger Taxonomie, also einfachen Aufgabenformen, seien während eines Studiums wichtig, allein mit Blick auf Chancengerechtigkeit. Sämtliche Klausuren so komplex zu gestalten, dass der KI-Einsatz nicht mehr negativ ins Gewicht fällt, darin sieht der Fachmediendidaktiker kein Allheilmittel. „Wohlmöglich hieße das außerdem, dass wir den Einsatz von KI ungewollt automatisch voraussetzen.“ Um diesen Balanceakt zwischen „Integrität und Innovation“ bei Prüfungen drehte sich auch der Vortrag von Schröder und Giesbert während des großen Symposiums „Prüfen trotz und mit KI“, das jetzt an der FernUniversität stattgefunden hat (s. Infobox).
Prüfungsformate im Wandel
Doch wie sähe eine Prüfung idealerweise aus, die sich gegenüber dem Thema KI öffnet? „Es gab an unserer Fakultät eine Klausur, die die KI direkt zum Gegenstand gemacht hat“, nennt Giesbert ein Beispiel für eine kritische inhaltliche Auseinandersetzung. „Die Studierenden mussten einen Text analysieren, den ChatGPT verfasst hat.“ Es gibt aber auch Konzepte, die die Live-Nutzung von KI-Tools einpreisen – wenn auch nicht voraussetzen. „Zugenommen haben etwa Portfolio-Prüfungen.“ Ähnlich wie bei einer Hausarbeit kann hier nicht gesichert überprüft werden, dass keine KI genutzt wird. „Es gibt also das Agreement mit den Lehrenden, dass sie auf angemessene Art und Weise dokumentieren, was sie da tun.“
 Foto: Privat / Nadja Moutevelidis
Foto: Privat / Nadja Moutevelidis
„Es gibt drei Reaktionsweisen auf die KI-Nutzung. Man kann sie verbieten, man kann sie zulassen oder man kann sie begleiten.“
Andreas Giesbert, KSW-Fachmediendidaktiker
Dishes and Laundry
„Die Portfolio-Prüfungen haben schon etwas Multimodales“, weist Angela Schröder auf den vielseitigen Ansatz hin. „Ich finde es gut, wenn wir nicht nur die restriktiven Maßnahmen neu denken, sondern die Prüfungsform an sich!“ Wie lässt sich die KI produktiv einsetzen? „Um der allgegenwärtigen ‚Verdachts-Hermeneutik‘ entgegenzutreten, könnte man die KI ja auch aktiv als Punkt in die Darstellung von Ergebnissen mitaufnehmen.“ Dossiers, digitale Ausstellungen oder Video-Essays etwa ließen sich nicht einfach so mit einer KI zusammenkopieren; vielmehr bestehe eine lebendige Wechselwirkung zwischen Studierendem und wissenschaftlichem Produkt. „Im Fall einer Poster-Präsentation kann die KI zum Beispiel sehr hilfreich sein bei der visuellen Gestaltung.“ Die Schreibdidaktikerin führt hier die Stichworte „Dishes and Laundry“ an: Geschirrspülen und Wäschewaschen – im übertragenen Sinn soll die KI solche unliebsamen Aufgaben übernehmen, damit der Mensch mehr Kraft für kreative, intellektuelle Leistungen hat.
Über das Symposium
Das Symposium „Prüfen trotz und mit KI: fachspezifische Perspektiven“ hat die Bedeutung und den Einfluss von KI für die fachspezifischen Prüfungsleistungen beleuchtet: in Bezug auf fachdisziplinäre Perspektiven, didaktische Einbindung und rechtliche Rahmenbedingungen. Veranstaltet haben es KI-Campus-Hub NRW, KI:edu.nrw und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Die Hauptorganisation an der FernUniversität in Hagen als Tagungsort lag bei Prof. Dr. Claudia de Witt, Prorektorin für Lehre, Studium und KI in Bildungsprozessen, KI-Campus-Hub NRW und Leitungsteam des Forschungszentrums CATALPA sowie Caroline Berger-Konen, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrgebiet und KI-Campus-Hub NRW.
KI ist kein Selbstläufer
„Wir müssen auch die Lehrenden befähigen und aufklären“, beruhigt Schröder zudem. Aber: „ChatGPT erschafft mit nur einem Prompt keine Hausarbeiten.“ Tatsächlich eine schlüssige und erkenntnisreiche Abschlussarbeit mithilfe des Sprachmodells zu erstellen, würde tiefe Kenntnisse und viel Detailarbeit erforderlich machen. „Jemand, der in der Lage ist, derart gut auf der Metaebene zu prompten, hat eine Leistung erbracht, die über die eigentliche Leistung einer Hausarbeit hinausgeht“, findet Schröder. Mehr noch: Eventuell könnten KI-Tools sogar die Durchlässigkeit erhöhen – etwa, indem sie Nichtmuttersprachler:innen den Einstieg in die deutsche Wissenschaftssprache erleichtern oder als Tutor eingesetzt werden, die im virtuellen Austausch den Denkprozess beflügeln. „Wie eine Art Geburtshilfe für die eigene Erkenntnisleistung.“
Prozess statt Produkt
Auch Giesbert ist hoffnungsvoll: „Klug eingesetzte Tools können das wissenschaftliche Schreibniveau angleichen!“ Hierin sieht er eine große Chance: „Wir wollen bei einer Prüfung ja ohnehin nicht zuerst prüfen, dass die Person eine bestimmte Form einhalten kann, sondern, dass sie sich Wissen angeeignet hat.“ Diese Unterscheidung werde künftig wichtiger. Damit stehe zugleich der bisweilen elitäre und exklusive Habitus der Akademia auf dem Prüfstand. „Die Erstellung des Produkts und die Erschließung des Gegenstandes sind zwei verschiedene Dinge. Ich kann etwas noch so toll aufschreiben und trotzdem nichts durchdrungen haben.“ Hierfür sei ChatGPT selbst das beste Beispiel: „Kann gut schreiben, hat aber gar nichts verstanden.“





