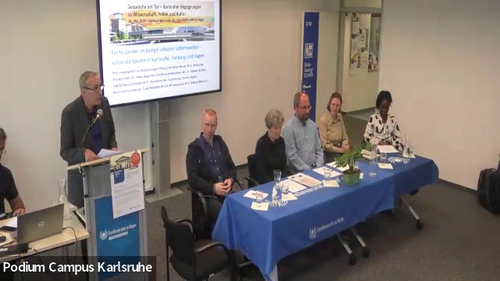Gespräche am Tor - Karlsruher Begegnungen zu Wissenschaft, Politik und Kultur
Ferne Länder im Spiegel urbaner Lebenswelten –
koloniale Spuren in Karlsruhe, Freiburg und Hagen
15. Mai 2024, 18 Uhr
Podiumsgespräch zur Ausstellungseröffnung „Fernes Hagen. Kolonialismus und wir“ (15.05.-31.07.2024) mit Nora Häuser M.A. (Karlsruhe Postkolonial), Dr. Heiko Wegmann (Freiburg-postkolonial.de), Dr. Fabian Fechner und Barbara Schneider M.A. (Kuratoren der Ausstellung „Fernes Hagen. Kolonialismus und wir“) und Mariette Nicole Afi Amoussou M.A. (Meine Welt e.V. und Black Academy, Mannheim)
Flyer zur Veranstaltung (PDF 318 KB)
Vom schwierigen Umgang mit unserer „kolonialen Kontinuität“ – historische Aufarbeitung und heutige Verantwortung
In „einer Art kolonialen Phantasie wirkt die mediale Darstellung nichtweißer Menschen bis heute fort“. Mit diesen Worten schlug Mariette Nicole Afi Amoussou die Brücke vom Kolonialismus zum heutigen Rassismus, der die damalige koloniale Konstruktion „des Anderen“ – nicht als Mensch, sondern als Objekt – bis heute fortschreibt. Indem Amoussou die Wurzeln des wissenschaftlichen Rassismus bis in die europäische Aufklärung hinein verfolgte, zeigte sie eine „koloniale Kontinuität“ auf, die eine der wesentlichen Grundlagen des westlichen Selbstverständnisses in der globalen Auseinandersetzung massiv in Frage stellt.
Zur Eröffnung der Ausstellung „Fernes Hagen. Kolonialismus und wir“ am Campus Karlsruhe diskutierte ein kompetent besetztes Podium die postkoloniale Aufarbeitung der Stadtgeschichten Hagens, Freiburgs und Karlsruhes. Dr. Fabian Fechner und Barbara Schneider M.A. (Lehrgebiet Geschichte Europas in der Welt, FernUniversität in Hagen; Kuratoren der Ausstellung „Fernes Hagen. Kolonialismus und wir“), Nora Häuser M.A. (Karlsruhe Postkolonial) und Dr. Heiko Wegmann (Freiburg-postkolonial.de) vertieften im stadtgeschichtlichen Vergleich drei thematische Schwerpunkte, welche die Reproduktion kolonialen Wissens im öffentlichen Stadtraum, die Partizipation von Vertretern aus Bürgerschaft, Wirtschaft und Handel an Kolonialunternehmen sowie den erinnerungspolitischen Umgang mit diesem historischen Erbe bis in die Gegenwart hinein betrafen. Für den Überschlag zur Gegenwart sorgte Mariette Nicole Afi Amoussou (Meine Welt e.V. und Black Academy, Mannheim), indem sie die drei Gesprächsrunden jeweils abschließend kommentierte: Vor dem Hintergrund der Erfahrungen nichtweißer Menschen in Deutschland sprach sie Querschnittsthemen wie Rassismus, die eigene Geschichte der kolonisierten Regionen und Gesellschaften sowie die kolonialen Kontinuitäten im westlichen Selbstverständnis an.
In der ersten Gesprächsrunde zeichnete das Podium die Reproduktion kolonialen Wissens sowohl für die jeweilige Stadtgesellschaft als auch für die Kolonien nach, wobei Ausstellungen etwa in Form sog. „Völkerschauen“, die Aktivitäten der Kolonialvereine und die Musealisierung von Raubgut in den drei Städten angesprochen wurden. Insbesondere für Freiburg spielte die Kolonialbewegung als „Transmissionsriemen“ (Wegmann) für die politische und innergesellschaftliche Durchsetzung der deutschen Kolonialziele sowie den Kolonialrevisionismus nach dem Ersten Weltkrieg eine maßgebliche Rolle. In Hagen ist die Kunstsammlung Karl Ernst Osthaus‘, die mit ihren ethnologischen Objekten dann in das Folkwang-Museum einfloss, hervorzuheben. Für Karlsruhe ist neben der Beteiligung der damaligen Technischen Hochschule (heute KIT) von „einer breiten Masse der Gesellschaft“ (Häuser) auszugehen, die an der Reproduktion kolonialen Wissens und der Ausbeutung der Kolonien beteiligt war. Abschließend hob die Runde auf die Entmenschlichung ab, die dem kolonialen Blick auf nichtweiße Menschen prinzipiell zugrunde lag und es erst möglich macht, nichtweiße Menschen in „Völkerschauen“ auszustellen oder heute rassistisch anzugreifen. „Wir nutzen Begriffe, wir nutzen Konzepte aus der Kolonialzeit, weil wir eben nicht genug Aufarbeitung haben. Denn die Menschen, die damals von uns kolonisiert worden sind, sind immer noch ‚die Anderen‘, d.h. wir haben diese Menschen woanders verortet und diese Verortung bleibt bis heute bestehen.“ (Amoussou)
Den wirtschaftlichen Profit, den Bürgerschaft, Wirtschaft und Handel aus den Kolonialunternehmen zogen, gewichtete die zweite Gesprächsrunde ganz unterschiedlich. In diesem Kontext sind für Freiburg die sich explosionsartig vermehrenden Kolonialwarengeschäfte sowie die im Deutschen Kolonialverein bzw. dann der Deutschen Kolonialgesellschaft organisierte wirtschaftliche Elite (der Präsident der Handelskammer sowie Fabrikanten wie die Seidenspinnerei Metz AG) anzuführen. In Hagen sind neben mehreren kleinen Unternehmen und der Verbindung zur Vereinigten Evangelischen Mission Wuppertal das gesamte gehobene Bürgertum hervorzuheben, das in der Kolonialbewegung sehr aktiv war, während für den Kolonialen Kriegerverein (gegründet 1912) erstmals auch Arbeiter, Kleinbürger und kleine Beamte nachweisbar sind. Somit war „das Denken in kolonialer Agitation kein Elitenphänomen gewesen, sondern es war ein Phänomen, das sämtliche Bevölkerungsschichten betroffen hat“ (Fechner). In Karlsruhe spielte neben den vielen Kolonialwarenläden auch der Rheinhafen eine gewisse Rolle im Warenaustausch mit den Kolonien, wobei jedoch der 1872 gegründeten Munitionsfabrik (heute Sitz des ZKM) als einer der bedeutendsten Munitionsproduzenten in Europa eine maßgebliche Funktion in den deutschen Kolonialkriegen – etwa auch bei der Niederschlagung des sog. Boxeraufstands in China (1900/01) – zufiel. Anhand des Karlsruher Falls lässt sich auch aufzeigen, wie die bürgerschaftliche Teilhabe am Kolonialprofit über den damaligen Kolonialwarenhandel in manchen neokolonialen Handelsbeziehungen des heutigen Einzelhandels (Import von Kaffee, Kakao, Tee als billigere Rohprodukte aus Afrika, Asien, Lateinamerika) fortwirkt. In diesem Kontext sind noch zahlreiche weitere, bis heute auf Seiten der ehemaligen Kolonialmächte fortwirkende Profite aufzuzeigen: Neben den Artefakten in Museen, die eigentlich restituiert werden müssten, betrifft dies etwa auch die Errungenschaften der vorwiegend im globalen Norden zugänglichen Gesundheitsversorgung, die zum Teil auf Menschenversuchen in Afrika beruhen.
In seiner dritten Gesprächsrunde befasste sich das Podium mit der übergreifenden Frage nach dem Umgang mit dem Erbe des Kolonialismus und dessen Aufarbeitung in der Erinnerungskultur – die, um es vorwegzunehmen, von allen Beiträgern als unzureichend bewertet wurde. Am besten fällt die Bilanz noch für Freiburg aus, wo schon ab 1968 vielfältige anti- bzw. postkoloniale Initiativen im zivilgesellschaftlichen Bereich, dann auch mit Heiko Wegmanns Forschungsprojekt im fachwissenschaftlichen Umfeld zu beobachten sind, so dass das Thema inzwischen „im Herzen der Stadt gelandet ist“ (Wegmann). Die kolonialgeschichtliche Aufarbeitung der Stadtgeschichte Hagens setzte erst mit einem von Barbara Schneider und Fabian Fechner 2018 angestoßenem und seither intensiv fortgesetzten Projekt ein. Für die kolonialgeschichtliche Erinnerungskultur in Karlsruhe fällt die Bilanz eher ungenügend aus, wobei neuere Initiativen der PH Karlsruhe und des KIT sowie die von Nora Häuser angestoßenen Forschungen zu „Karlsruhe Postkolonial“ positiv hervorzuheben sind; demgegenüber traf der städtische Umgang etwa mit kolonialgeschichtlich konnotierten Straßennamen oder dem im öffentlichen Stadtraum der Südstadt tradierten Buffalo-Bill-Mythos auf Kritik. Abschließend beklagte das Podium die in der deutschen Gesellschaft wirksame „koloniale Kontinuität“, in der es seit dem Verlust der deutschen Kolonien „sozusagen keine Pause gab“ (Amoussou). Zur Überwindung dieser kolonialen Amnesie sei es nötig, dass wir alle eine Sensibilität für die fortwirkende koloniale Begrifflichkeit und Sprache entwickeln; nicht zuletzt ist es wünschenswert, dass sich die Gemeinschaft schwarzer Menschen im Interesse einer „balancierten Geschichte“ (Amoussou) aktiv in die Erinnerungskultur einbringen kann, um diese um zivilgesellschaftliche und aktivistische Initiativen zu bereichern, die bisher gegenüber dem gesamtgesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs nicht als gleichwertig anerkannt werden.
Im Anschluss an das Podiumsgespräch sorgte ein reger Austausch mit dem Publikum für die Vertiefung mehrerer zuvor angesprochener Themen, was auch noch den nachfolgenden Stehempfang und die Kuratorenführung durch die Ausstellung beherrschte. Unter vielen anderen Aspekten bezog sich die Diskussion auf die maßgebliche, aber differenziert zu beurteilende Rolle von Mission und Kirche bei der kolonialen Inbesitznahme, Durchdringung und Ausbeutung außereuropäischer Regionen und Gesellschaften. Auch die Präsenz des Kolonialismus in der ländlichen Lebenswelt bzw. seine unterschiedliche Ausprägung in städtischen Zentren und in der Provinz wurden erörtert. Die Vertreter der afro-deutschen Community bzw. Diaspora mahnten angesichts der ungenügenden Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte in der deutschen Gesellschaft eine stärkere Einbeziehung ihrer Erfahrungen und Erinnerungen an, um endlich die Basis für eine gemeinsame Aufarbeitung zu schaffen.
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Veranstaltung durch den Vergleich der Städte Freiburg, Karlsruhe und Hagen den Erkenntnisgewinn stadt- und lokalgeschichtlicher Tiefenbohrungen gerade bei einem Querschnittsthema wie der Kolonialgeschichte aufgezeigt hat, das auf der lokalen Ebene im Gegensatz zu nationalgeschichtlich aufgeladenen Fragen eine bessere pädagogische und öffentliche Vermittlung findet. Allerdings hat die Veranstaltung, insbesondere dank der anschließenden Diskussion mit dem Publikum, auch viele neue Fragen aufgeworfen und Forschungslücken sichtbar gemacht. So verdient neben der Stadtgeschichte auch die traditionelle Firmengeschichte eine postkolonial orientierte Reflexion, die zur Erweiterung um ihre kolonialgeschichtlichen Anteile führen mag. Auch der langfristigen informellen kolonialen Verstrickung ist angesichts der kurzweiligen Dauer der deutschen Kolonialherrschaft ein größeres Gewicht einzuräumen.
Letztendlich ist deutlich geworden, dass postkolonialer Diskurs und kolonialgeschichtliche Forschung unsere Lebenswelt und unser Selbstverständnis in dreierlei Hinsicht massiv in Frage stellen: So betrifft die Auseinandersetzung mit dem Thema zunächst unsere ganz individuelle Lebenswelt, indem die Umbenennung von Straßen oder der Sturz von Denkmälern am Kern unserer historisch gewachsenen lokalen Identität nagt. Dann beeinträchtigt der postkoloniale Diskurs auch unser kollektives, auf dem sog. westlichen Wertekanon gegründetes Selbstverständnis, indem er plausibel aufzeigt, dass die Universalität des seit der Aufklärung postulierten Menschenrechtskonzepts nicht erst durch das China Xi Jinpings, sondern bereits durch die europäischen Aufklärer und Kolonialherrscher selbst geleugnet wurde. Schließlich berührt die Frage nach dem Stand und den Defiziten der historischen Aufarbeitung des Kolonialismus unsere historischen Narrative und Geschichtsbilder, unsere fachwissenschaftlichen und methodischen Grundlagen, mit deren Hilfe wir Geschichte schreiben: Für die deutsche Zeitgeschichte und das (west-)deutsche Selbstverständnis seit der zweiten Nachkriegszeit beziehen sich diese Grundlagen ganz wesentlich auf die Deutung des Holocaust als singuläres Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine Deutung, die nun allerdings durch den deutschen Genozid an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika (1904-1908) und viele weitere Kolonialverbrechen ihren paradigmatischen Stellenwert zu verlieren droht (sog. Zweiter Historikerstreit). Und das in die Zukunft ausgreifende Potential kolonialer Aneignung ist damit noch gar nicht erfasst: Ist doch aus dem ursprünglich räumlichen im Zuge des Klimawandels ein zeitlicher Kolonialismus geworden, bei dem abermals der globale Norden die Zukunft künftiger Generationen schädigt, wovon erneut der globale Süden besonders betroffen ist – so dass nicht nur die Aufarbeitung unserer Kolonialgeschichte, sondern die Dekolonialisierung des Klimawandels und seiner Folgen das Gebot einer erneuerten postkolonialen Agenda ist. Die im Podiumsgespräch verhandelte „koloniale Kontinuität“ scheint der rote Faden zu sein, der all diese Fragen durchzieht, und eignet sich daher als Arbeitsbegriff für die dringend nötige weitere Auseinandersetzung mit der Thematik.
Mariette Nicole Afi Amoussou, M.A. International Management, ist seit 2010 aktiv in internationaler Projektarbeit u.a. in Benin, Deutschland, Frankreich und Kamerun involviert; seit 2012 berät und begleitet sie Institutionen und Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen Antirassismus-Sensibilisierung und nichtdiskriminierende Prozessbegleitung; weiterhin konzipiert sie als Prozessbegleiterin pädagogische Konzepte für Organisationen, die für Freiwilligendienste tätig sind. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen Community-Arbeit und Empowerment von Diaspora-Organisationen sowie von Menschen bzw. Kindern und Jugendlichen mit Migrationserfahrung; weitere Schwerpunkte sind Capacity Building, Dekolonisierung und Reflexion zu kolonialen Kontinuitäten. Sie ist Mitgründerin des Vereins „Meine Welt e.V.“ und der "Black Academy" in Mannheim.
Fabian Fechner, Dr., geb. 1982, ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrgebiet „Geschichte Europas in der Welt“ an der FernUniversität in Hagen. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die kritische Kartographiegeschichte, die Kulturkontaktforschung und der „Kolonialismus vor Ort“. Zusammen mit Barabara Schneider hat er die Ausstellung „Fernes Hagen. Kolonialismus und wir“ kuratiert.
Nora Häuser, geb. 1993, B.A. Political and Social Studies und Indologie, M.A. Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit sowie M.A. Sozialwirtschaft, schrieb eine Masterarbeit zum Thema „Karlsruhe postkolonial“. Sie bietet Stadtführungen zu den kolonialen Spuren Karlsruhes an und betreibt den Instagram-Kanal @karlsruhe_postkolonial. Momentan forscht sie zum kolonialpolitischen Wirken des Karlsruhers Professors Theodor Rehbock (1864-1950).
Barbara Schneider, M.A., geb. 1959, lehrt am Lehrgebiet „Geschichte Europas in der Welt“ an der FernUniversität in Hagen. Sie ist Mitbegründerin des Arbeitskreises „Hagen postkolonial“ (2018) und promoviert zur Verbreitung okzidentaler Kunstmusik in Japan. Zuletzt beschäftigte sie sich mit der regionalen Jugendarbeit im Rahmen des Kolonialrevisionismus. Zusammen mit Fabian Fechner hat sie die Ausstellung „Fernes Hagen. Kolonialismus und wir“ kuratiert.
Heiko Wegmann, Dr., geb. 1970, freier Sozialwissenschaftler und Historiker, Gründer und Leiter des Forschungs- und Bildungsprojektes „freiburg-postkolonial.de“, Mitautor der 2018 vom Stadtarchiv Freiburg herausgegebenen Studie „Freiburg und der Kolonialismus – Vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus“, Ko-Kurator der Stuttgarter Ausstellung „Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus“. Er forscht derzeitig im Auftrag des Stadtarchivs Karlsruhe zu Karlsruhes Kolonialgeschichte.
Hinweis auf weitere Ressourcen:
- Fabian Fechner/Barbara Schneider (Hg.), Koloniale Vergangenheiten der Stadt Hagen, Hagen 2019 (Inhaltsverzeichnis).
- Ausstellung: Fernes Hagen. Kolonialismus und wir, online: https://www.fernuni-hagen.de/universitaet/events/ausstellung-fernes-hagen-kolonialismus-und-wir.shtml [19.05.2024].
- Fabian Fechner/Barbara Schneider (Hg.), Fernes Hagen. Kolonialismus und wir (Ausstellungskatalog), mit einer Übersicht der kolonialkritischen Ausstellungen seit 1989 zu deutschen Städten, 4. Auflage, Hagen 2023 (Inhaltsverzeichnis).
- Nora Häuser, Karlsruhe Postkolonial, Projektseite an der PH Karlsruhe 2021, online: https://www.ph-karlsruhe.de/projekte/karlsruhe-postkolonial [19.05.2024].
- Alexandra Korbut, Der Maji-Maji-Krieg im Spiegel der Karlsruher Presse. Eine Dokumentenanalyse der Karlsruher Zeitung 1905-1906, Masterarbeit an der PH Karlsruhe o.J., online: https://www.ph-karlsruhe.de/www/pr/karlsruhe_postkolonial/pdf/Masterarbeit_Korbut_Alexandra.pdf [19.05.2024].
- Heiko Wegmann, Freiburg Postkolonial, Projektseite online: https://www.freiburg-postkolonial.de/index.htm [19.05.2024].
- Heiko Wegmann, Vom Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika zur Kolonialbewegung in Freiburg. Der Offizier und badische Veteranenführer Max Knecht (1874-1954), Freiburg 2019 (Inhalt).
- Bernd-Stefan Grewe/Markus Himmelsbach/Johannes Theisen/Heiko Wegmann, Freiburg und der Kolonialismus. Vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus, Freiburg 2018 (Inhalt).
- Beatrix Hoffmann-Ihde (Hg.), Freiburg und Kolonialismus. Gestern? Heute!, Freiburg 2023 (Verlagspräsentation).
- Mariette Nicole Afi Amoussou, Mit der eigenen Stimme sprechen. Interview, in: nd 16.08.2022, online: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166160.schwarze-akademie-mit-der-eigenen-stimme-sprechen.html [19.05.2024].
- Black Academy, Mannheim, Projektseite online: https://black-academy.org/ [19.05.2024].
- Diaspora Policy Interaction, Projektseite online: https://www.dpi-online.org/de/about [19.05.2024].
- Mikaél Assilkinga, et al., Atlas der Abwesenheit. Kameruns Kulturerbe in Deutschland, Heidelberg 2023; online: https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1219 [19.05.2024]; Forschungsdaten online: https://www.tu.berlin/kuk/forschung/projekte/laufende-forschungsprojekte/umgekehrte-sammlungsgeschichten-mapping-kamerun-in-deutschen-museen/forschungsdaten [19.05.2024].
Ihre Rückmeldung
E-Mail: Ihr Kommentar bzw. Ihre Nachfrage
Konnten Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen und/oder haben Sie Kommentare und Nachfragen zum Inhalt des Vortrags? Wir leiten diese an den Referenten bzw. die Referentin weiter (falls Sie eine Rückantwort wünschen, bitte E-Mail-Kontakt mit angeben).