European Patent Litigation Certificate
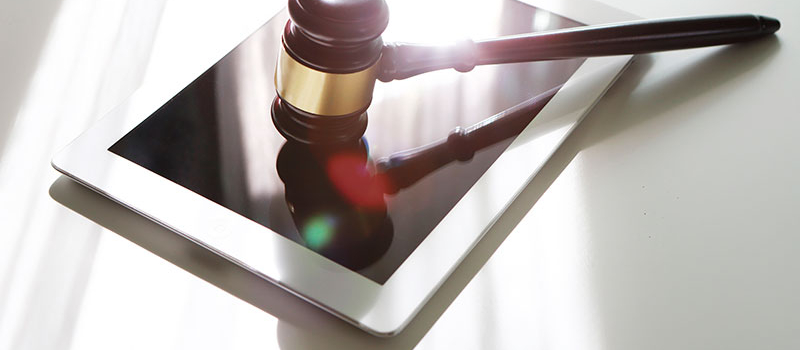 RunPhoto/Photodisc/GettyImages
RunPhoto/Photodisc/GettyImages
Zertifikatsstudium „European Patent Litigation Certificate“ (EPLC)
Sommersemester 2024 – Wintersemester 2024/2025
Zeitraum
August 2024- April 2025
Kosten
Absolvent*innen des Studiums „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“: 3.500 €
Sonstige Teilnehmende: 3.800 €
Weitere Infos
fernuni.de/rewi-patent
Seit dem Jahr 2023 ist das Einheitliche Patentgericht (EPG) grundsätzlich für Streitigkeiten über europäische Patente, insbesondere auch Patente mit einheitlicher Wirkung, zuständig. Dabei sind Patentanwältinnen und -anwälte – mit entsprechender Qualifikation – nach dem zugrundeliegenden Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht allein, ohne Hinzuziehung von Rechtsanwältinnen oder -anwälten, vertretungsbefugt. Die Qualifikation kann unter anderem durch ein spezielles Zertifikat (European Patent Litigation Certificate) nachgewiesen werden.
In Kooperation mit der Patentanwaltskammer hat die FernUniversität dafür ein Zertifikatsstudium entwickelt, das vom EPG nun akkreditiert wurde und die über 30-jährige Kooperation beider Institutionen fortsetzt und vertieft. Verantwortet wird das Studienangebot vom Kurt-Haertel-Institut, welches zur Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität gehört
Der Studienverlaufsplan sieht zwei Semester vor, in denen der Lehrstoff von 120 Stunden in einem Mix aus asynchronen Lehrveranstaltungen, Online-Vorlesungen und drei Präsenzphasen in München vermittelt wird. Neben den spezifischen Inhalten zum EPG werden die Grundlagen des allgemeinen und internationalen Privatrechts sowie des Patentverfahrensrechts (Nichtigkeit, Verletzung) aufgefrischt und rechtsvergleichend vertieft. Einen besonderen Praxisbezug wird die dritte Präsenzphase herstellen, in welcher die Teilnehmenden die verfahrensrechtlichen Inhalte vor dem EPG auch in Kleingruppen durch Verfahrenssimulationen (ähnlich einem Moot Court) erlernen sollen. Die Abschlussprüfung erfolgt durch eine vierstündige Klausur und eine mündliche Prüfung, die als Gruppenprüfung (je Prüfling eine Prüfungszeit von 20 Minuten) in Präsenz oder online durchgeführt werden wird. Der Kurs findet weitgehend, die Prüfung ausschließlich in deutscher Sprache statt.
Anmeldung und Einschreibung
Die Einschreibung an der FernUniversität erfolgt über die Patentanwaltskammer.
Patentanwaltskammer
Tal 29
80331 München
Fon: +49 89 24227832
https://www.patentanwalt.de/de/
Überblick über den Studienverlauf
| Termin | Vermittelte Kursinhalte (anteilige Stundenzahl) | Std. |
| Auftaktveranstaltung (online) August (34./35. KW) |
| --- |
| Online (asynchron) August (35. KW) |
| 7 |
| Online (synchron) August/ September (35./36. KW) |
| 7 |
| Online (asynchron) September (36. KW) |
| 5 |
| Präsenz 1 12.09.-15.09.2024 |
| 23 |
| Online (asynchron) Oktober (40.-41. KW) |
| 10 |
| Online (synchron) November (44./45. KW) |
| 4 |
| Präsenz 2 15.-17.11.2024 |
| 16 |
| Online (synchron) Dezember (49.-51. KW) |
| 8 |
| Online (asynchron) Januar 2025 (2.-5. KW) |
| 12 |
| Online (asynchron) Februar 2025 (6.-9. KW) |
| 8 |
| Präsenz 3 13.-16.03.2025 |
| 20 |
| Mündliche Prüfungen April 2025 (14.-18. KW) |
| --- |
| Summe | 120 |
Prüfungsordnung des weiterbildenden Studiums „Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren“ an der FernUniversität in Hagen vom 07. Mai 2024
§ 1 Ziele des Studiums
§ 2 Zulassung zum Studium, Gebühren
§ 3 Gliederung, Dauer und Umfang des Studiums
§ 4 Prüfungen und Gesamtergebnis
§ 5 Durchführung einer mündlichen Prüfung als häusliche Videoprüfung
§ 6 Nachteilsausgleich
§ 7 Prüfende und Prüfungsausschuss
§ 8 Wiederholung von Prüfungen
§ 9 Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 10 Zeugnis, Zertifikat im Sinne von Art. 48 Abs. 2 EPGÜ
§ 11 Einsicht in Prüfungsakten
§ 12 Veröffentlichung und In-Kraft-Treten
§ 1 Ziele des Studiums
Das weiterbildende Studium vermittelt den Studierenden die erforderlichen Kenntnisse zum Erwerb der Erlangung des Zertifikats zur Führung europäischer Patentstreitverfahren gem. Art. 48 des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht.
§ 2 Zulassung zum Studium, Gebühren
(1) Zum Studium wird zugelassen, wer der FernUniversität in Hagen von der Patentanwaltskammer benannt worden ist.
(2) Die Patentanwaltskammer benennt der FernUniversität in Hagen die Personen, die über die Voraussetzungen eines abgeschlossenen Hochschulstudiums hinaus,
(a) gem. § 29 der Patentanwaltsordnung (PAO) in dem von der Patentanwaltskammer geführten Patentanwaltsverzeichnis eingetragen worden sind,
(b) nach § 1 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Patentanwälte (Patentanwaltsausbildungs- und -prüfungsverordnung – PatAnwAPrV) als Bewerberinnen oder Bewerber für den Beruf des Patentanwalts zugelassen sind und ein Studium nach § 7 Abs. 3 PAO erfolgreich abgeschlossen haben,
(c) als European Patent Attorneys nach Art. 134 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) in die beim Europäischen Patentamt geführte Liste eingetragen sind,
(d) als Angehörige von Patentanwaltsberufen gem. §§ 20 f. Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) berechtigt sind, sich im Geltungsbereich der Patentanwaltsordnung niederzulassen, oder
(e) Patentassessorinnen und Patentassessoren nach § 11 PAO sind.
(3) Das Studium endet zum Ende des Semesters, ohne dass es einer Exmatrikulation bedarf, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 2 entfallen.
(4) Für die Teilnahme am Studium sind von den Studierenden Gebühren zu entrichten, die auf der Homepage der FernUniversität in Hagen und in den Anmeldeunterlagen veröffentlicht sind.
§ 3 Gliederung, Dauer und Umfang des Studiums
(1) Das Studium umfasst Vorlesungen und praktische Übungen in Form von Fernstudienphasen (synchron und asynchron) sowie Präsenzphasen. Die Regelstudiendauer beträgt zwei Semester.
(2) Der Einstieg in das Studium wird in der Regel einmal jährlich angeboten.
(3) Das Studium gliedert sich in acht Kurse mit einem Workload von insgesamt 10 ECTS (250 Arbeitsstunden). Das Curriculum umfasst:
a) Kurs 1: Einführung in das Recht
b) Kurs 2: Grundlagen des Privatrechts und des IPR
c) Kurs 3: Rolle und Bedeutung des EuGH im Patentrecht
d) Kurs 4: Die Durchsetzung von Patenten
e) Kurs 5: Grundlagen des einheitlichen europäischen Patentschutzes
f) Kurs 6: Vergleichender Überblick über den Patentverletzungs- und Nichtigkeitsprozess
g) Kurs 7: Das Übereinkommen über das Einheitspatentgericht
f) Kurs 8: Das Verfahren vor dem Einheitspatentgericht.
§ 4 Prüfungen und Gesamtergebnis
(1) Das Studium endet mit einer kursübergreifenden Gesamtprüfung, die zwei eigenständige Teilprüfungen in Form einer vierstündigen Klausur und einer etwa 20-minütigen mündlichen Prüfung je Prüfling umfasst.
(2) Die Klausur findet im Anschluss an die letzte Präsenzphase statt. Sie wird von einer prüfenden Person bewertet und mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ benotet. Das Prüfungsergebnis wird spätestens sechs Wochen nach der Prüfung bekannt gegeben.
(3) Zur mündlichen Prüfung wird zugelassen, wer die Klausur bestanden hat. Sie kann als Gruppenprüfung durchgeführt werden. Die mündliche Prüfung wird von Prüfungskommissionen abgenommen, denen jeweils drei Mitglieder als prüfende Personen angehören. Jeweils zwei Mitglieder jeder Prüfungskommission sollen Mitglieder oder Angehörige der FernUniversität in Hagen sein. Eines dieser Mitglieder der Prüfungskommission übernimmt den Vorsitz. Ein weiteres Mitglied der Prüfungskommission soll eine von der Patentanwaltskammer vorgeschlagene prüfende Person sein. Das Prüfungsergebnis wird im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben.
§ 5 Durchführung einer mündlichen Prüfung als häusliche Videoprüfung
(1) Mündliche Prüfungen können auf Antrag im Einvernehmen mit allen Prüfungsbeteiligten als häusliche Videoprüfung abgenommen werden. Die häusliche Videoprüfung ist ein Prüfungsgespräch unter Abwesenden und wird über eine von der Hochschule bereitgestellte Kommunikationssoftware durchgeführt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Prüfungsform.
(2) Sie kann sowohl als Einzelprüfung als auch als Gruppenprüfung erfolgen. Die Teilnahme ist für alle Prüfungsbeteiligten ortsunabhängig möglich.
(3) Die Zulassung zu einer häuslichen Videoprüfung erfolgt im Einverständnis aller Prüfungsbeteiligten zum Videoformat. Studierende erteilen ihr Einverständnis durch ihre Anmeldung zu einer Prüfung im Videoformat. Die Zulassung kann abgelehnt oder die bereits erteilte Zulassung zurückgenommen werden, wenn seitens eines Prüfungsbeteiligten Zweifel an einer störungsfreien Durchführung bestehen und diese vor Beginn der Prüfung gegenüber dem Prüfungsamt mitgeteilt wurden. Die Zulassung zur häuslichen Videoprüfung soll insbesondere dann versagt werden, wenn bereits bei einem vorherigen Prüfungstermin ein Prüfungsabbruch aufgrund technischer Probleme erfolgte.
(4) Die Durchführung einer häuslichen Videoprüfung ist zwingend mit den nachfolgenden besonderen Mitwirkungspflichten verbunden, denen sich die Prüfungsbeteiligten mit ihrer Zustimmung zum Videoformat unterwerfen:
1. Die Studierenden sind verpflichtet, sich für die Dauer einer häuslichen Videoprüfung allein in einem Raum aufzuhalten und die erforderliche technische Ausstattung für eine Ton- und Bild- Kommunikation vorzuhalten. Die erforderliche technische Ausstattung umfasst einen Computer einschließlich Kamera, Mikrofon und Lautsprecher bzw. Headset, sowie eine für eine Videokonferenz ausreichende Internetverbindung.
2. Alle Prüfungsbeteiligten stellen sicher, dass sie in ihrem Aufenthaltsraum während der Prüfung nicht gestört werden.
3. Die Studierenden dürfen während der Prüfung nicht mit Dritten kommunizieren und keine Hilfsmittel nutzen, die nicht ausdrücklich zugelassen sind. Ein Versuch, gegen diese Pflicht zu verstoßen, gilt als Täuschungsversuch und führt zum Nichtbestehen der Prüfung; die Prüfung gilt in diesem Fall als mit 5,0 bewertet. Prüferinnen und Prüfer sollen im Falle eines begründeten Täuschungsverdachts die Prüfung unterbrechen und die Studierenden anhören. Den Studierenden ist die Möglichkeit zu geben, den Täuschungsverdacht zu entkräften, indem sie durch eine geeignete Fokussierung der Kamera eine Kontrolle des Raumes auf weitere Personen oder auf nicht-zugelassene Hilfsmittel hin ermöglichen. Der Täuschungsverdacht und der weitere Ablauf sind im Prüfungsprotokoll zu dokumentieren.
4. Alle Prüfungsbeteiligten sind verpflichtet, ggf. auftretende technische Störungen schnellstmöglich zu beseitigen. Die Prüfung wird für die Dauer einer Störung unterbrochen; Art und Dauer der Störung soll im Prüfungsprotokoll vermerkt werden. Im Falle einer kurzzeitigen Unterbrechung soll die Prüfung nach dem Ende der Störung fortgesetzt werden. Im Falle längerer oder mehrfacher Störungen soll die Prüfung abgebrochen werden. Bei Prüfungsabbruch gilt die Prüfung als nicht unternommen, wenn die Störung nicht von der/dem Studierenden zu vertreten ist. Die Entscheidung über die Fortsetzung der Prüfung trifft die Prüfungskommission.
5. Eine Aufzeichnung der Prüfung findet nicht statt. Der Mitschnitt einer häuslichen Videoprüfung, ganz oder auch teilweise, ist allen Prüfungsbeteiligten untersagt.
§ 6 Nachteilsausgleich
(1) Studierenden, die auf Grund einer Behinderung, chronischen Erkrankung oder mutterschutzrechtlichen Bestimmungen an der Ableistung einer Prüfung in der von der Prüfungsordnung vorgesehenen Weise gehindert sind, wird auf Antrag ein angemessener Nachteilsausgleich gewährt. Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die entsprechenden Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes.
(2) Studierenden im Sinne des Absatz 1 kann insbesondere gestattet werden, die Prüfung an einem anderen Ort, mit einer anderen Dauer oder mit anderen Hilfsmitteln abzulegen, soweit dies zur Kompensation ihrer Einschränkung erforderlich ist und die Kompensation nicht die durch die Prüfung festzustellende Leistungsfähigkeit betrifft. Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag einzelfallbezogen gewährt. Er soll sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken.
(3) Die Beeinträchtigung muss durch ein fachärztliches Attest nachgewiesen werden. Dieser Nachweis soll auch eine nicht bindende Empfehlung für die Art und den Umfang einer empfohlenen Kompensation enthalten.
(4) Der Antrag ist rechtzeitig, in der Regel 6 Wochen, vor der Prüfungsanmeldung zu stellen.
§ 7 Prüfende und Prüfungsausschuss
(1) Zur Abnahme der Prüfungen sind alle am Studium beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Privatdozierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Lehrbeauftragten, Autorinnen und Autoren der Studienbriefe sowie Betreuenden der Kurse befugt, soweit sie die Voraussetzungen des § 65 HG NRW erfüllen, ohne dass es einer weiteren Bestellung bedarf. Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
(2) Für die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben setzt der Fakultätsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät eine wissenschaftliche Leitung ein. Die wissenschaftliche Leitung ist berechtigt, weitere Personen zur Prüferin oder zum Prüfer zu bestellen, soweit sie die Voraussetzungen des § 65 HG NRW erfüllen. Die wissenschaftliche Leitung entscheidet ferner über Fragen der Prüfungsorganisation, den Nachteilsausgleich und die Anerkennung von Prüfungsleistungen.
(3) Für Widersprüche gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Leistung im Rahmen einer berufsbezogenen Prüfung zugrunde liegt, ist der Prüfungsausschuss der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zuständig. Das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen nicht mit. Die Prüfungsver-fahrensordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät findet entsprechende Anwendung.
§ 8 Wiederholung von Prüfungen
Nicht bestandene Prüfungsleistungen können beliebig oft wiederholt werden, solange das Studium angeboten wird.
§ 9 Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Ein Prüfling kann innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen vor der jeweiligen Prüfungsleistung (Klausur / mündliche Prüfung) von der Prüfungsleistung zurücktreten. Ein späterer Rücktritt ist nur aus triftigem Grund möglich.
(2) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung, z.B. durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder Kommunikationsmittel, zu beeinflussen, so gilt die jeweilige Teilprüfung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Die Aufsichtsperson hat einen Täuschungsverdacht in einer Niederschrift unter Angabe der Einzelheiten zu vermerken. Sie soll Beweise sichern und ist berechtigt, von den Studierenden bei der Prüfung genutzte Hilfs- und Kommunikationsmittel einzuziehen und an die wissenschaftliche Leitung zur abschließenden Klärung des Täuschungsverdachts weiterzuleiten. Die entsprechenden Gegenstände werden nach Abschluss des Verfahrens wieder an die/den Betroffenen ausgehändigt. Verweigern Studierende die Herausgabe der bei der Prüfung zur Beweissicherung von der Aufsichtsperson verlangten Hilfs- oder Kommunikationsmittel, so ist die Weigerung in der Niederschrift zu vermerken und die Prüfung gilt als „nicht-bestanden“.
(3) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören, kann von der jeweiligen Aufsichtsperson in der Regel nach einer einmaligen Verwarnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Der Sachverhalt ist in einer Niederschrift zu vermerken. Die Prüfung gilt im Falle des Ausschlusses als mit „nicht bestanden“ bewertet.
§ 10 Zeugnis, Zertifikat im Sinne von Art. 48 Abs. 2 EPGÜ
(1) Das Studium endet nach bestandener Prüfung mit einem Weiterbildungszertifikat gem. § 62 des HG NRW (Zeugnis). Das Zeugnis wird in der Regel innerhalb von vier Wochen nach der Prüfung von der wissenschaftlichen Leitung und vom Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unterschrieben und mit dem Siegel der Fakultät versehen.
(2) Sofern die Absolventinnen und Absolventen als zugelassene Vertreter vor dem Europäischen Patentamt gemäß Art. 134 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) eingetragen sind, wird ein Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren im Sinne von Art. 48 Abs. 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) verliehen. Abs. 1 S. 2 gilt entsprechend.
§ 11 Einsicht in Prüfungsakten
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird auf Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen der Gesamtprüfung gewährt.
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses bei der wissenschaftlichen Leitung zu stellen. Die Einsichtnahme erfolgt in den Räumlichkeiten des Kurt-Haertel-Instituts in Hagen oder der Patentanwaltskammer in München. Die Fertigung einer originalgetreuen Kopie ist gestattet.
§ 12 Veröffentlichung und In-Kraft-Treten
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der FernUniversität in Hagen in Kraft.


