Buchempfehlungen
Die Lehrenden des Instituts für Soziologie stellen vor
Patrick Heiser: Die Arbeitslosen von Marienthal
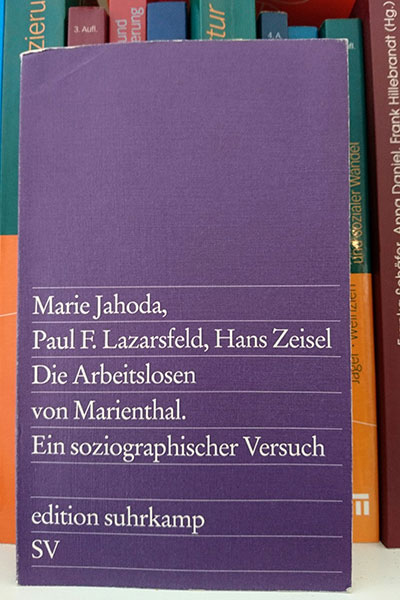 Abbildung: edition suhrkamp
Abbildung: edition suhrkampMarie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel (1933):
Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit
Das kleine Büchlein „Die Arbeitslosen von Marienthal“ fasziniert mich aus drei Gründen: wegen seiner Entstehungsgeschichte, wegen der Rolle Jahodas als weibliche Forscherin und wegen seiner kreativen methodologischen Pionierarbeit.
Es gibt nicht viele Bücher, die ich selbst schon mehrfach mit Freude gelesen habe, die ich schon einige Male an Kolleginnen und Kollegen verschenkt habe und mit denen sich auch meine Studierenden offenbar vergleichsweise gern auseinandersetzen. Erst recht gibt es nicht viele wissenschaftliche Bücher, die in acht Sprachen übersetzt und sogar verfilmt worden sind. All dies trifft auf die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ zu, die von Paul F. Lazarsfeld, Marie Jahoda und Hans Zeisel erstmals im Jahr 1933 publiziert und 1988 von Karin Brandauer unter dem Titel „Einstweilen wird es Mittag“ verfilmt wurde – wie Sie gleich sehen werden, das Zitat eines Studienteilnehmers.
Worum es geht
Es geht um Marienthal, ein österreichischer Industrieort unweit von Wien, der bis zum Ende der 1920er Jahre von der Textilindustrie gelebt hatte. Infolge der Weltwirtschaftskrise mussten zwischen 1929 und 1930 jedoch alle entsprechenden Fabriken Marienthals nach und nach geschlossen werden – nahezu die gesamte Bevölkerung wurde innerhalb kürzester Zeit arbeitslos. Diese Verdichtung einer Krise weckte das Interesse Lazarsfelds, seinerzeit Leiter der Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle an der Universität Wien. Ihm bot sich in Marienthal so etwas wie eine Laborsituation, in der die Folgen von Arbeitslosigkeit an einem Ort überschaubarer Größe in all ihren Facetten untersucht werden konnten – eine ausgesprochen seltene und durchaus vielversprechende Ausgangslage für empirische Forscherinnen und Forscher. Über die Zielsetzung ihrer Studie schreiben Jahoda und Zeisel im Vorwort zur ersten Auflage:
„Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war, mit den Mitteln moderner Erhebungsmethoden ein Bild von der psychologischen Situation eines arbeitslosen Ortes zu geben. Es waren uns von Anfang an zwei Aufgaben wichtig. Die inhaltliche: zum Problem der Arbeitslosigkeit Material beizutragen – und die methodische: zu versuchen, einen sozialpsychologischen Tatbestand umfassend, objektiv darzustellen.“ (Jahoda et al. 2014 [1933]: 9)
Das Interesse der Forscher/innen war mithin auf den von Arbeitslosigkeit geprägten Sozialraum gerichtet, den sie – wie es im Untertitel ihrer Studie heißt – in Form eines „Soziogramms“ zu beschreiben und deuten versuchten. Im Zentrum ihrer Untersuchung stand also nicht der bzw. die einzelne Arbeitslose, sodass wir es weniger mit einer subjektbezogenen psychologischen als mit einer genuin sozialwissenschaftlichen Studie zu tun haben. Zu deren Durchführung hielten sich Jahoda und Zeisel mit Unterstützung eines 17-köpfigen Teams unter der Leitung Lazarsfelds von November 1931 bis Mai 1932 in Marienthal auf. Hier beeindruckten sie insbesondere drei Beobachtungen:
- Obwohl die Arbeitslosen von Marienthal über mehr Zeit verfügten, nutzten sie immer seltener die öffentliche Bibliothek, lasen weniger Zeitungen und besuchten immer seltener den Turn-, Gesangs- oder Theaterverein.
- Obwohl die Arbeitslosen unter ihrer ökonomischen Situation litten, sank ihr politisches Engagement. Sie besuchten immer seltener politische Versammlungen und beendeten ihre Mitgliedschaften in politischen Parteien.
- Die Arbeitslosen unternahmen außerdem weniger Versuche, in anderen Orten Arbeit zu finden, als diejenigen Bewohner/innen Marienthals, die noch Arbeit hatten.
Die Forscher/innen charakterisierten Marienthal daher als „müde Gemeinschaft“, die von Apathie, geringerem gesellschaftlichen Engagement und erhöhtem Misstrauen gegenüber den Mitmenschen geprägt war. Die Haltung der Marienthaler/innen beschrieben sie in Form der folgenden Typologie:
- Die Resignierten (48 Prozent)
„Das gleichmütig erwartungslose Dahinleben, die Einstellung: man kann ja doch nichts gegen die Arbeitslosigkeit machen, dabei eine relativ ruhige Stimmung, sogar immer wieder auftauchende heitere Augenblicksfreude, verbunden mit dem Verzicht auf eine Zukunft, die nicht einmal mehr in der Phantasie als Plan eine Rolle spielt, schien uns am besten gekennzeichnet durch das Wort ‚Resignation‘.“ (ebd.: 70) - Die Ungebrochenen (16 Prozent)
„Ihre Haushaltungsführung ist ebenso geordnet wie die der Resignierten, aber ihre Bedürfnisse sind weniger reduziert, ihr Horizont ist weiter, ihre Energie größer.“ (ebd.: 71) - Die Verzweifelten (11 Prozent)
„Diese Menschen sind völlig verzweifelt, und nach dieser Grundstimmung erhielt die Verhaltensgruppe ihren Namen. Wie die Ungebrochenen und Resignierten halten auch sie in ihrem Haushalt noch Ordnung, pflegen auch sie ihre Kinder.“ (ebd.: 71) - Die Apathischen (25 Prozent)
„Mit apathischer Indolenz läßt man den Dingen ihren Lauf, ohne den Versuch zu machen, etwas vor dem Verfall zu retten. […] Das Hauptkriterium für diese Haltung ist das energielose, tatenlose Zusehen. Wohnung und Kinder sind unsauber und ungepflegt, die Stimmung ist nicht verzweifelt, sondern indolent.“ (ebd.: 71f.)
Die Haltung der Arbeitslosen von Marienthal schien abhängig zu sein von ihrer ökonomischen Situation. So verfügen die Ungebrochenen über durchschnittlich 34 Schilling pro Monat und Haushalt, die Resignierten über 30, die Verzweifelten über 25 Schilling und die Apathischen über lediglich 19 Schilling. Da seinerzeit in Österreich noch keine wohlfahrtsstaatliche Absicherung existierte, die das Existenzminimum dauerhaft gesichert hätte, kann die Typologie nicht nur als ein statisches Nebeneinander distinkter Haltungen gelesen werden, sondern auch als Stadien eines psychischen Abgleitens, an dessen Ende Verzweiflung und Apathie stehen.
Die „müde Gemeinschaft“ spiegelt sich beispielsweise in der von den Forscher/innen gemessenen Gehgeschwindigkeiten der Marienthaler Bevölkerung. Sie stellten fest, dass Männer deutlich langsamer gingen als Frauen und auf der gerade einmal 100 Meter langen Hauptstraße deutlich häufiger stehen blieben – die meisten ganze drei Mal. Auf diese Beobachtung stützen die Forscher/innen ihre These vom „doppelten Zeiterleben“ für Frauen und Männer:
„Doppelt verläuft die Zeit in Marienthal, anders den Frauen und anders den Männern. Für die letzteren hat die Stundeneinteilung längst ihren Sinn verloren. Aufstehen – Mittagessen – Schlafengehen sind die Orientierungspunkte, die übriggeblieben sind.“ (ebd.: 84)
Ein weiteres Erhebungsinstrument der Marienthal-Studie bildeten sogenannte Zeitverwendungsbögen. In Form eines Formulars wurden die Teilnehmenden gebeten, stundenweise anzugeben, was sie zu einer bestimmten Tageszeit getan hatten. Aus einem dieser Zeitverwendungsbögen stammt der oben genannte Filmtitel „Einstweilen wird es Mittag“. Ein arbeitsloser Mann nämlich wusste seine Tätigkeit während 10.00 und 11.00 Uhr nicht anders zu beschreiben, als mit eben jenen Worten. Werfen wir einen Blick auf seinen recht deprimierend wirkenden Zeitverwendungsbogen:
- 06.00-07.00 Uhr: Stehe ich auf
- 07.00-08.00 Uhr: Wecke ich die Buben, da sie in die Schule gehen müssen
- 08.00-09.00 Uhr: Wenn sie fort sind, gehe ich in den Schuppen, bringe Holz und Wasser herauf
- 09.00-10.00 Uhr: Wenn ich hinaufkomme, fragt mich meine Frau, was sie kochen soll; um dieser Frage zu entgehen, gehe ich in die Au
- 10.00-11.00 Uhr: Einstweilen wird es Mittag
- 11.00-12.00 Uhr: (leer)
- 12.00-13.00 Uhr: 1 Uhr wird gegessen, da die Kinder aus der Schule kommen
Frauen hingegen waren trotz ihrer Arbeitslosigkeit nach wie vor mit der Führung des Haushalts und der Versorgung ihrer Kinder beschäftigt – was ihnen mehr Halt und Orientierung bot:
„So ist der Tag für die Frauen von Arbeit erfüllt: Sie kochen und scheuern, sie flicken und versorgen die Kinder, sie rechnen und überlegen und haben nur wenig Muße neben ihrer Hausarbeit, die in dieser Zeit eingeschränkter Unterhaltsmittel doppelt schwierig ist.“ (ebd.: 90)
Was mich fasziniert
Das kleine Büchlein „Die Arbeitslosen von Marienthal“ fasziniert mich aus drei Gründen: wegen seiner Entstehungsgeschichte, wegen der Rolle Jahodas als weibliche Forscherin und wegen seiner kreativen methodologischen Pionierarbeit.
Als die Studie im Juni 1933 erstmals im Leipziger Hirzel-Verlag erschien, hatten die Nationalsozialisten in Deutschland bereits die Macht übernommen. Da sowohl Lazarsfeld als auch Jahoda und Zeisel jüdische Wurzeln hatten, musste ihre Studie zunächst ohne die Nennung ihrer Namen publiziert werden. Auch dieses für die Forscher/innen sicherlich schmerzliche Vorgehen konnte jedoch nicht verhindern, dass der Vertrieb der ersten Auflage alsbald verboten und die bereits produzierten Exemplare vernichtet wurden. Erst in den nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichten Auflagen der Marienthal-Studie werden Lazarsfeld, Jahoda und Zeisel namentlich genannt.
Bemerkenswert ist auch die Rolle Jahodas, die sich als eine der ersten Frauen überhaupt einen Namen als Feldforscherin und sozialwissenschaftliche Autorin machen konnte. Als Aktivistin der Revolutionären Sozialisten wurde sie 1936 in Wien verhaftet. Aufgrund internationaler Interventionen kam sie zwar nach neunmonatiger Haft frei, musste Österreich jedoch umgehend verlassen. Zunächst emigrierte sie nach Großbritannien, ging aber 1945 nach New York, wo sie bis 1958 an der New School for Social Research Sozialpsychologie lehrte und mit den ebenfalls geflohenen Mitgliedern des Frankfurter Instituts für Sozialforschung zusammenarbeitete. Im Jahr 1962 wurde Jahoda auf den Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der University of Sussex in Großbritannien berufen, wo sie bis zu ihrer Emeritierung tätig war und im Jahr 2001 verstarb. Aus ihrer Feder stammt der Großteil der Marienthal-Studie – Lazarsfeld hingegen steuerte zu späteren Auflagen ein in methodologischer Hinsicht lesenswertes Vorwort bei und Zeisel ein ausführliches Nachwort. Aber nicht nur aufgrund der zentralen Rolle Jahodas ist die – um einen seinerzeit noch nicht bekannten Begriff zu bemühen – Gendergerechtigkeit der Studie bemerkenswert: Zehn weibliche Forscherinnen und Hilfskräfte standen sieben männlichen gegenüber. Darüber hinaus wurden männliche und weibliche Studienteilnehmer/innen in der Studie stringent gleichberechtigt zitiert. Und schließlich beinhaltet die Studie, wie Sie bereits gesehen haben, einen expliziten Vergleich der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Männer bzw. Frauen.
In methodischer Hinsicht leisteten Lazarsfeld, Jahoda und Zeisel schließlich Pionierarbeit. Heutzutage etablierte Erhebungs- und Auswertungsmethoden nämlich lagen in den 1930er Jahren noch nicht vor. Die Forscher/innen mussten daher selbst kreativ werden und Methoden entwickeln, die auch heute noch wesentliche Grundlagen für die empirische Sozialforschung bilden. Ihr Soziogramm Marienthals zeichneten sie durch eine originell anmutende Kombination verschiedenster Erhebungsmethoden. Insbesondere war ihnen daran gelegen, nicht nur quantitative Daten wie etwa Arbeitslosenstatistiken zu berücksichtigen, sondern auch das subjektive Erleben von Arbeitslosigkeit zu erfassen. Hierzu erhoben sie qualitative Daten, die bis dato noch nicht wissenschaftlich genutzt worden waren, sondern am ehesten in Form sogenannter „sozialer Reportagen“ von Zeitungen und Schriftstellern vorgelegen hatten. Diesbezüglich schreibt Lazarsfeld in seinem Vorwort zur Neuauflage im Jahr 1960 die bemerkenswerten Sätze:
„Es gibt so viel zu tun, dass man nicht seine Zeit mit ‚Methodenstreit‘ vergeuden soll. Eine integrale Soziologie wird mit allen empirischen und analytischen Mitteln an konkrete Probleme heranzugehen und dadurch eine realistische Synthese finden.“ (ebd.: 23)
Quantitative Daten wurden beispielsweise in Form der Anzahl von Bibliotheksbesuchen, Zeitungsabonnements und Vereinsmitgliedschaften sowie durch die Inventarisierung des Besitzes der untersuchten Haushalte erhoben; qualitative unter anderem in Form von Interviews, Beobachtungen und Tagebuchanalysen. Darüber hinaus organisierten die Forscher/innen eine Kleidersammlung und besuchten zunächst 100 Familien, um zu erfragen, welche Kleidungsstücke am dringendsten benötigt würden. Im Anschluss an diese Besuche wurden Beobachtungs- und Gesprächsprotokolle angefertigt. Die Verteilung der gespendeten Kleider wurde dann zur Akquise von Teilnehmer/innen für ausführliche Interviews genutzt. Dieselben Personen wurden schließlich auch bei anderen Gelegenheiten teilnehmend beobachtet – beispielsweise im Rahmen der ebenfalls von den Forscher/innen veranstalteten Tanz-, Schnittzeichen- und Erziehungsberatungskurse.
Ein derartiges methodisches Vorgehen mutet ausgesprochen kreativ und gegenstandsangemessen an. Die Marienthal-Studie bildet daher zweifellos einen der wichtigsten Meilensteine empirischer – und insbesondere qualitativer – Sozialforschung.
Wo Sie weiterlesen können
- Engler, Steffani, Brigitte Hasenjürgen. 2002. „Ich habe die Welt nicht verändert“. Lebens-erinnerungen einer Pionierin der Sozialforschung. Biographisches Interview mit Marie Jahoda. Weinheim: Beltz.
- Heiser, Patrick. 2017. Meilensteine der qualitativen Sozialforschung. Eine Einführung entlang klassischer Studien. Wiesbaden: SpringerVS.
- Jahoda, Marie, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel. 1933/2014. Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. 24. Aufl. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Müller, Reinhard. 2008. Marienthal. Das Dorf – Die Arbeitslosen – Die Studie. Innsbruck: Studienverlag.
Thomas Matys: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit
 Abbildung: S. Fischer
Abbildung: S. FischerPeter L. Berger, Thomas Luckmann (1966):
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie
Dieses Buch hat mich, gelinde gesagt, stark beeinflusst, ja fasziniert – ich halte es bis heute für eines der besten Einführungsbücher in die Soziologie.
Was es heißt, zu studieren, wurde mir – wie es für eine Textwissenschaft üblich ist – im Verlauf meines Studiums selbstredend „definitorisch“ beigebracht: Studieren heißt „fleißig sein“ bzw. „sich üben in …“. Nun gut, ich sollte mich also „üben in“. „In“ „Soziologie“ – aber was war Soziologie? Die „Wissenschaft von der Gesellschaft“ lernte man bald ebenso schnell. Im Nu befand man sich im praktischen Vollzug des Anschluss-Fragens und -Befragens von Wörtern und Begriffen, die – und das ist ja das große Identitätsmerkmal bspw. der Soziologie in Absetzung zu vielen naturwissenschaftlichen Fächern – eben nicht eine Definition aufwiesen, sondern mehrere. Und das nicht genug; Die Definitionen selbst verlangten wieder nach Definitionen, die ihrerseits Polyvalenzen boten, was auf nicht mehr und nicht weniger hindeutete, als dass Begriffe und Definitionen in der Soziologie oft umstritten, manchmal sogar umkämpft waren. „Gesellschaft“ schien nun einmal so ein Begriff zu sein. War er nicht eigentlich der Hauptbegriff der Soziologie bzw. sollte er es nicht sein? Ja, per definitionem wohl. Aber die Antworten, die seitens „der Wissenschaft“ (Soziologie) und vonseiten „des Alltags“ kamen, konnten nur mehr als unbefriedigend sein. Etwa: „Die Gesellschaft sind alle Bewohner der Bundesrepublik Deutschland“ oder „Die Gesellschaft ist die Summe aller Individuen“. Auch wenn man diesen autorenlosen Definitionen autoren-gestützte, wie die bspw. des französischen Soziologien Émile Durkheim, Definitionen gegenüberstellte, dass nämlich das Ganze mehr als die Summe seiner Teile sei, ließ einen das zwar aufhorchen, allerdings war man auch noch nicht viel weiter.
Was mit dem Begriff des „Alltags“ angezeigt war, so weiß ich mindestens heute, bedeutete, dass ich bereits voll im Thema war: Relativ bald in den Soziologie-Vorlesungen stand dann das Buch von Berger und Luckmann, „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie“, auf dem Programm. Dieses Buch hat mich, gelinde gesagt, stark beeinflusst, ja fasziniert – ich halte es bis heute für eines der besten Einführungsbücher in die Soziologie. In erster Linie lernte man etwas über „andere“ Soziologen bzw. über Soziologie überhaupt. Denn, so schwante es einem ja zu Beginn des Studiums, es sollte ja wohl nicht wie in vielen Naturwissenschaften zugehen, innerhalb derer naturgesetzliche Definitionen im Vorhinein gesetzt werden können und wir dann unsere weiteren Erkenntnisse davon ableiteten. Nein, Sozialwissenschaften sollte etwas Anderes sein, etwas, was die Menschen- und nicht die Naturgemachtheit unserer „sozialen Wirklichkeit“ erklären konnte. So behaupteten nun Berger und Luckmann, dass die Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert sei und dass die „Wissenssoziologie“ die Prozesse zu untersuchen habe, in denen das geschehe (S. 1). Und – das passte gut zu meinen bisherigen Lebenserfahrungen – es sollte nicht um irgendein Wissen gehen, sondern um „Alltagswissen“, welches mit den Mitteln „der“ Soziologie erforscht werden sollte. Hier war das „Lebenswelt“-Konzept von Alfred Schütz prägend. Bei der Alltagswelt – und dem Wissen darüber – war ja jedem Menschen sozusagen klar, dass sie bzw. es bestand. In der Regel pflegte man eine Routine, Alltagswissen gerade nicht in Frage zu stellen, sondern den dahinterstehenden Mechanismen für sein Zustandekommen, nennen wir es zusammenfassend „Erfahrung“, zu vertrauen.
Nichts, na ja, kaum etwas, ahnend näherte ich mich dem schwierigen Begriff der „Institution“: Im Plural mindestens als die zweckmäßigen Leitregeln zu verstehen, die auf Dauer gestellt sind und aufgrund ihres Fortwährens prozesshaft „Institutionalisierungen“ darstellen. Damit war man längst angekommen in den grundlegenden Aussagen von „großen“ Soziologen, wie es wohl der Franzose Émile Durkheim und der Deutsche Max Weber ohne Zweifel waren. Beide lieferten sicherlich berühmte und folgenreiche „Marschbefehle“ für die Soziologie, auf die sich Berger und Luckmann beriefen und gleichsam eine Richtung des soziologischen Denkens vorgaben: Auf der einen Seite war dort Émile Durkheim (1858 - 1917, „Die Regeln der soziologischen Methode“; auf der anderen Seite Max Weber (1864 - 1920, „Wirtschaft und Gesellschaft“). Die formulierte Differenz hat mich gefesselt: Durkheim sagt: „Die erste und grundlegendste Regel besteht darin, die soziologischen Tatbestände wie Dinge zu betrachten“, und Weber sagt: „Für die Soziologie (im hier gebrauchten Wortsinn, ebenso wie für die Geschichte) ist aber gerade der Sinnzusammenhang des Handelns Objekt der Erfassung“. Die Übung bestand nun darin, zu begreifen, dass die beiden Thesen sich einander nicht widersprachen. Ihre Darstellung aus einer möglichst integrativen Perspektive steht im Mittelpunkt der Bemühungen von Berger und Luckmann. Es ist ja gerade der Doppelcharakter der Gesellschaft als objektive Faktizität (Gesellschaft als objektive Wirklichkeit“: S. 49 f.) und subjektiv gemeinter Sinn („Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit“: S. 139 f.), der sie zur „Realität sui generis“, also zur Realität eigener Art, macht, um einen anderen zentralen Begriff von Durkheim zu verwenden. Die soziale Realität existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, innerhalb und außerhalb der Akteure. Damit wurde es quasi möglich, eine Grundfrage der Soziologie in Anschluss an Berger/Luckmann wie folgt zu formulieren: „Wie ist es möglich, daß subjektiv gemeinter Sinn zu objektiver Faktizität wird?“ (S. 20) oder, in der Terminologie Webers und Durkheims: Wie ist es möglich, dass menschliches Handeln (Weber) eine Welt von Dingen (Durkheim) hervorbringt?
Später im Studium werde ich dann weiter lernen, dass Berger/Luckmann dem sog. „Sozialkonstruktivismus“ zuzuordnen sind, also einer Richtung, die danach fragt, wie soziale Ordnung als kollektiv produzierte zustande kommt. Derartig zugespitzt wurde mein Interesse zwar weiter gesteigert, zwecks Herantastens an die Pointe des Buches musste ich mehr aus ihm lernen: Vorn angesprochene Institutionalisierung (vgl. S. 49 ff.) vollzieht sich als Form einer reziproken Typisierung habitualisierter Handlungen. Das bedeutet, dass der Mensch gemäß Berger/Luckmann Handlungen, besser: Typen von Handlungen, durch stetes Wiederholen verinnerlicht. Dies geschieht reziprok, d. h. immer im Zusammenspiel mit Anderen. So werden beide, der „Eine“ und der „Andere“, jeweils für sich über typisierte Handlungen zu bestimmten Typen von Handelnden. Ein wichtiger Bestandteil dieses Typenbildens ist die Rollenhaftigkeit des modernen Subjekts: Menschen bzw. Handelnde erwarten von jeweils anderen bestimmte typisierte Handlungsmuster (S. 78). Wichtig ist nun, dass der Prozess der Institutionalisierung in drei Phasen verläuft: a) Externalisierung: Menschen bringen sich anfänglich in materiellen und/oder ideellen Produkten zum Ausdruck; b) Objektivation: Auch andere Menschen wiederholen diese Produktion und nehmen davon wechselseitig Kenntnis, verallgemeinern dadurch Wissen, stellen quasi Muster des Denkens und Handelns fest und c) Internalisierung (S. 139 ff.): Die Menschen akzeptieren dann die gesellschaftlich vorgefundenen Regeln, die sie nicht mehr hinterfragen und machen sie zu inneren Überzeugungen, wie denn richtig gedacht und gehandelt werde.
So weit, so gut? Betrachtet man die Stoßrichtung des Buches als Ganzes, fasse ich zusammen, dass Lernergebnis 1 bedeutete, mich wenn schon nicht auf die Schultern soziologischer Riesen zu setzen, ich mich zumindest einmal ihnen angenähert habe. Lernergebnis 2: Jede noch so als objektiv empfundene Realität – sei sie „alltagsweltlich“ oder „wissenschaftlich“ – ist zumindest in den Sozialwissenschaften eine (inter-) subjektiv erzeugte. Lernergebnis 3: Es wird die Dialektik von Gesellschaft und Mensch deutlich: Die Gesellschaft ist ein menschliches Produkt und der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt. Auch wenn Berger und Luckmann so verstanden werden wollen, dass sie nicht Durkheim und Weber hatten zusammenführen wollen – ich denke, man kann sagen, dass ein weiterer Riese mehrere Jahrzehnte zuvor bereits implizit Lernergebnis 3 vorgegeben hatte – kein Geringerer als Karl Marx, dieser wörtlich: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen“.
Dass es noch weitere Konstruktivismen neben dem Sozialkonstruktivismus Bergers und Luckmanns gibt und dass diese sich vor Allem daran abarbeiten, auf welche Weise eine wie auch immer geartete Wirklichkeit eigentlich „sein“ kann (bzw. im Vorhinein unterstellt wird), würde mir erst später im Rahmen weiterer Fleißarbeit bekannt werden. Also gut, möchte ich abschließend für mein Lieblingsbuch ins Feld führen: Diese Lernergebnisse sukzessive zu verinnerlichen, stellte einen Ausdruck des Einnehmens einer „Sowohl-als-auch“-Perspektive dar. Dieses wiederum ist nicht zu verstehen als eine „déformation professionelle“, etwa im Sinne eines typischen Sich-nicht-Entscheiden-Könnens oder einer Unfähigkeit von Soziologen, Ratschläge geben zu können, sondern Bewusstseinserweiterung in Richtung eines soziologischen, des „2.“, Blicks im besten Sinne, und dies ganz und gar drogenfrei. Ich hatte mir damals vorgenommen, dass 3., 4. und xte Blicke, ohne Kalauer in Bezug auf meine Kurzsichtigkeit, folgen sollten.
Uwe Vormbusch: Dialektik der Aufklärung
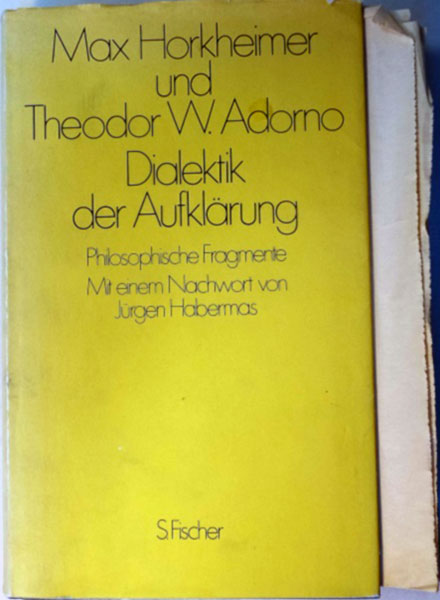 Abbildung: S. Fischer
Abbildung: S. FischerMax Horkheimer, Theodor W. Adorno (1947):
Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
Die Dialektik der Aufklärung habe ich zu Beginn meines Studiums gelesen. Das Buch war das Geschenk eines Freundes. Das war 1986. Ebenso gut hätte ich – wie viele andere aufgerüttelt durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl - Ulrich Becks „Risikogesellschaft“ lesen können. Im Gegensatz zu Ulrich Beck musste ich Adorno und Horkheimer allerdings nicht als Raubdruck lesen, das Buch war als Ergebnis der Renaissance der „Frankfurter Schule“ und des Entstehens einer über die Studentenbewegung hinausreichenden kritischen Öffentlichkeit seit den späten 1960er Jahren mittlerweile in einer schön gemachten Auflage des S. Fischer Verlags verfügbar. Die Wahl dieses Geschenkes war insofern alles andere als zufällig, als sie im Kontext eines Wandels des politischen Klimas und der ökonomischen Verhältnisse der Bundesrepublik stattfand. Nach den Studentenunruhen und der „Außerparlamentarischen Opposition“, nach den sozialliberalen und sozialstaatlichen Reformen der 70er und frühen 80er Jahre (denen auch die FernUniversität in Hagen ihre Existenz verdankt), aber auch nach den Ölpreisschocks der 1970er, dem absehbaren Ende des „kurzen Traums immerwährender Prosperität“ (Burkhardt Lutz) und am Beginn dessen, was wir heute die Ära des Neoliberalismus nennen, stellten Adorno und Horkheimer auch für diejenigen, die die Studentenbewegung biografisch verpasst hatten, die Frage, die zur Wurzel all dieser Probleme zu führen schien.
Diese Frage war, wie die Ideen der Aufklärung in einer Weise wirksam werden konnten, dass deren ursprüngliche Versprechen (vor allem dasjenige einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft) in ihr Gegenteil umschlagen. Adorno und Horkheimer haben ihre Überlegungen im Kontext ihrer historischen Erfahrung des Holocaust niedergeschrieben und hieran gezeigt, wie die Versprechen der Aufklärung in furchtbare Verbrechen mündeten. In den 1980er Jahren – noch vor der deutschen Wiedervereinigung – ging es zwar durchaus auch um andere Fragen und Probleme, vor allem um die Furcht vor einer ökologischen Katastrophe und vor einer gefährlichen Zuspitzung des Kalten Krieges. Horkheimer und Adorno schienen aber auch auf solche Gegenwartsprobleme eine Antwort parat zu haben in Gestalt einer Deutung der modernen Geschichte, in deren Zentrum eine dialektische Bewegung steht: die „Dialektik der Aufklärung“. Anhand verschiedener Textfragmente untersuchen sie die wechselseitige Verstrickung von Mythos und Vernunft, von Glauben und aufklärerischem Denken.
Eines dieser Fragmente ist Homers „Odyssee“. Odysseus, bekanntermaßen durch den erzürnten Gott Poseidon und die Gewalten des Meeres bedroht, rettet sich auf seiner Heimfahrt von Troja nach Ithaka ein ums andere Mal mit List und Betrug, um daheim Haus, Besitz und Frau zurück zu gewinnen. Was in jüngster Zeit als heroische Räuberpistole verfilmt wurde und auch für Adorno und Horkheimer „der Form des Abenteuerromans nähersteht“ (S. 53), illustriert für sie dennoch die moderne Vernunftgeschichte und ihre gesellschaftlichen Wirkungen. Für sie zeichnet sich im Homerischen Epos bereits eine spezifische Form der Vernunft ab: die instrumentelle Vernunft, die auf die Beherrschung der äußeren ebenso wie der inneren Natur des Menschen abzielt. Odysseus ist der Archetypus des rationalen und rational seine Interessen verfolgenden homo oeconomicus, das „Urbild eben des bürgerlichen Individuums“ (S. 50). Odysseus ist „listiger Einzelgänger“, dem sein teils schicksalhaftes, teils gewolltes Ausscheiden aus dem Kollektiv der Gefährten, dem also gerade seine „Isoliertheit die rücksichtslose Verfolgung des atomistischen Interesses“ (S. 69) gebietet. Die moderne Haltung des Odysseus, seine „Vernunft“, zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er – indem er allen Widrigkeiten zum Trotz nach Hause findet – über die Gewalten der Natur siegt, sondern auch dadurch, dass er – wissenshungrig wie die Aufklärung selbst – sich bewusst immer neuen Gefahren aussetzt, um neues Wissen zu erlangen. Erst hierdurch bilde er sich zu einem im Kern rationalen und seinen Interessen verpflichteten Individuum, so Adorno.
Dieser Subjektivierungsprozess findet nun aber nicht im Kontext moderner Institutionen wie des Marktes und des Staates statt (zu diesem Thema finden sich zahlreiche Abhandlungen in unseren Studienbriefen), sondern im Kontext mythischer oder durch mythische Gestalten heraufbeschworener Gefahren – Poseidon lässt grüßen. Den Herrschaftscharakter der aufgeklärten Vernunft arbeiten die Autoren u.a. an den rationalen Verboten heraus, die der gewitzte Odysseus für sich ersinnt. So singen auf einer Insel, die er passieren muss, die Sirenen ihren verlockenden Gesang – antike Urbilder der Loreley am Rhein. Die List des Odysseus richtet sich nun nicht allein gegen die Lockungen der Sirenengesänge, sondern auch gegen sich selbst: Vernunft herrscht eben nicht nur über ein „Draußen“, über Natur und Gesellschaft, sondern auch über das vernünftige Subjekt selbst, das sich ihr unterwirft, indem es sie gebraucht. Odysseus lässt sich an den Mast seines Schiffes binden, um den Sirenen sowohl zuhören als auch entkommen zu können. Denn wer immer ihnen lauscht, muss ihrem Ruf folgen und dabei sterben.
Odysseus aber will horchen ohne zu gehorchen, und dies gelingt ihm Adorno und Horkheimer zufolge allein um den Preis einer Sublimierung seiner Triebe und Gefühle. Denn je stärker die Lockungen der Sirenen werden, „umso stärker lässt er sich fesseln, so wie nachmals die Bürger auch sich selber das Glück umso hartnäckiger verweigerten, je näher es ihnen mit dem Anwachsen der eigenen Macht rückte“ (S. 40). Der vernünftig gegen die Welt und gegen sich handelnde Mensch unterwirft die Welt und sich selbst, indem er sinnlicher Erfahrung zugunsten rationalen Wissens und rationaler (Selbst-)Herrschaft entsagt. An die Stelle einer religiös begründeten Ethik (wie bei Max Weber) als Antrieb solcher Disziplinierung tritt bei Adorno die Vernunft selbst. Die Wirkung ist am Ende eine ganz ähnliche: der Gewinn von Kontrolle und Macht wird durch die Entfremdung des Subjekts von sich selbst und seinem triebhaften Leib erkauft. Dieser wird als bloßer Körper selbst zum Objekt der Zurichtung und der Disziplinierung: „Erst Kultur (also: die Vernunft; U.V.) kennt den Körper als Ding, das man besitzen kann, erst in ihr hat er sich vom Geist, dem Inbegriff der Macht und des Kommandos, als der Gegenstand, das tote Ding, >>corpus<<, unterschieden“ (S. 247).
Die Autoren rekonstruieren das Homerische Epos nicht von ungefähr. Für sie hat die Ausbreitung der instrumentellen Vernunft als weltbeherrschende Macht fatale Konsequenzen. Das „kalte Licht der Aufklärung“ lässt die Welt düster erstrahlen. Überall, in der Ökonomie, der Massenkultur, der Politik und in der Beziehung der Menschen zu sich selbst werden ihre zersetzenden Wirkungen spürbar. Das Programm der Aufklärung ist die Entzauberung der Welt. Aber anstatt „den Menschen die Furcht zu nehmen“, indem sie „Einbildung durch Wissen“ stürzt (S. 9), wird die Aufklärung – das ist die dialektische Volte ihrer Überlegungen - selbst zu einem Mythos. Die „vollends aufgeklärte Erde“ ist kein behaglicher Ort friedlicher Betätigung, sondern wird von einer unerbittlichen instrumentellen Vernunft umgearbeitet und dabei zu dem Produkt der Anwendung formaler Gleichungen und des Äquivalenzprinzips (sprich: des Marktes) degradiert. Die Welt wird das Produkt einer herrschaftsförmigen Wissenspraxis, die alles berechnen, alles formalisieren und alles vergleichbar machen will. Alles „Ungleichnamige“ (Differente, Individuelle, nicht Formalisierbare; vgl. S. 13 f.) wird vergleichbar gemacht, indem es auf abstrakte Größen reduziert wird. Die Revolution frisst ihre Kinder, und so wird auch die Aufklärung mit ihrer Durchsetzung zunehmend zum Mythos: den Mythen der logischen Erklärbarkeit und der kalkulatorischen Beherrschbarkeit der Welt, aus denen die Geschichten der ökonomischen Effizienz, der politischen Rationalität und schließlich der Disziplin des Selbst (s.o.) gesponnen werden.
Die Barbarei, die die Autoren am Faschismus exemplarisch beobachtet haben, endet nicht dort. Die „neue Art von Barbarei“ ist nicht auf ein politisch-kulturelles System beschränkt, auch wenn sie dort besonders furchtbar wirksam wurde. Sie findet sich ebenso in der modernen Massenkultur (der „Kulturindustrie“) wie in der Ökonomie. Insbesondere das kapitalistische System als Paradigma rationaler Herrschaft mache aus uns Allen das, was Adorno und Horkheimer uns in der Figur des Odysseus prototypisch vorhalten: individualisierte Konkurrenzsubjekte, die sich im Zuge ihrer rationalen Selbstbehauptung gegenüber sich und anderen „härten“. Das moderne Subjekt muss sich „an Leib und Seele nach der technischen Apparatur“ formen (S. 36) – und hiermit ist nicht nur im Marxschen Sinne die technische Apparatur der modernen Fabrik gemeint, sondern die rationalen Institutionen gesellschaftlicher Herrschaft überhaupt.
Worin liegt der Zauber dieses Buches? Dass es einen Zauber hat. Es lässt sich nicht lesen und nicht begreifen als ein Lehrbuch oder als eine wissenschaftliche „Tatsache“. Die Dialektik der Aufklärung ist ein Stück Aufklärungskritik, das – zusammen mit Herbert Marcuses Schriften - zu einem Mythos der entstehenden kritischen Öffentlichkeit der frühen Bundesrepublik avancierte. Das Buch erzählt damit nicht nur von der aufklärerischen Macht des Mythos und von dem Umschlag instrumenteller Vernunft in einen neuen Mythos (und das ist heute ebenso aktuell wie damals; siehe die Forschungen des Lehrgebiets zur Quantifizierung menschlicher Erfahrung), es verkörpert diesen in gewisser Weise auch. Aber nicht im schlechtesten Sinne, denn das Buch nimmt nicht die Form des von Adorno und Horkheimer so sehr kritisierten positivistischen research an, sondern bleibt fragmentarische, facettenreiche Literatur.
Habe ich damals verstanden, worum es Adorno und Horkheimer ging? Wohl kaum. Dennoch haben mich die Probleme, die die beiden hier formuliert haben, beeindruckt. Auch unbegriffene Bücher können Folgen haben und das ist vielleicht ein Grund mehr, ein Buch, das man auf Anhieb nicht versteht, nicht gleich fortzulegen. Manche Bücher werden schließlich und unmerklich Teil der automatischen Erfahrung und des professionellen Habitus (Bourdieu). Michel Callon und Bruno Latour würden vielleicht sagen, dass sie Aktanten darstellen, die an der Fabrikation unserer Erfahrungswirklichkeit mitstricken. Aber das ist eine neue Geschichte …


