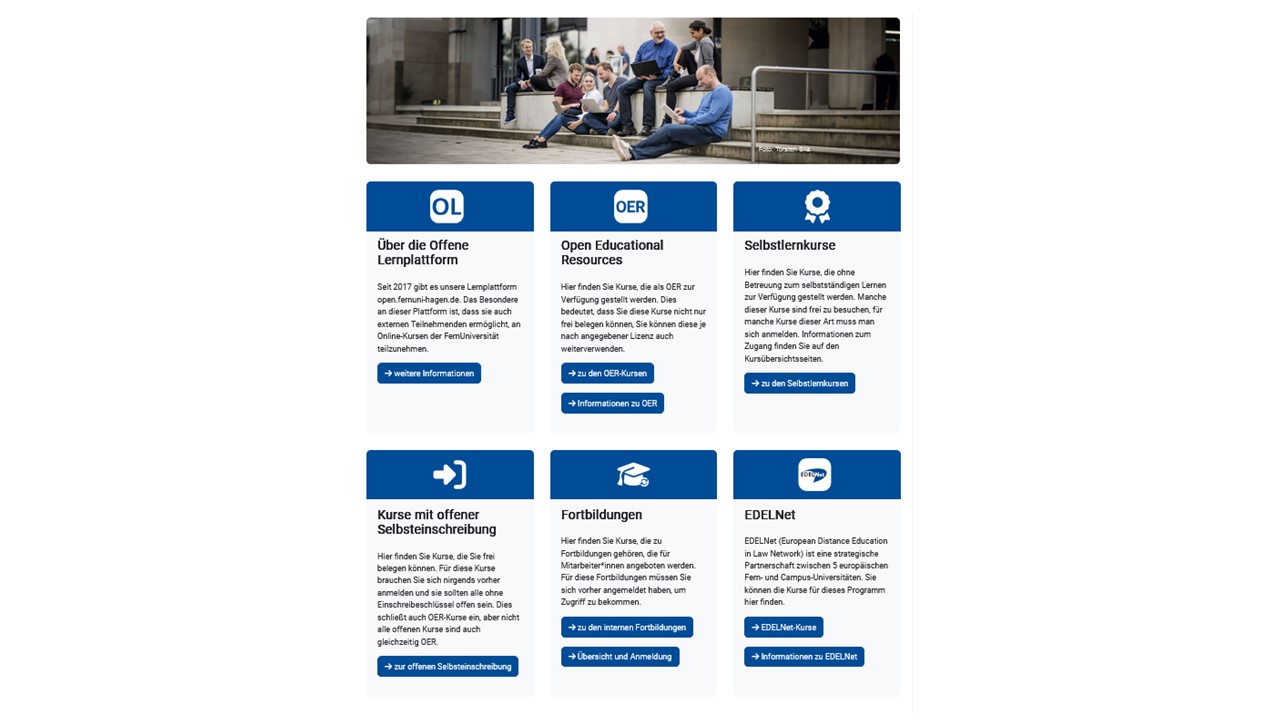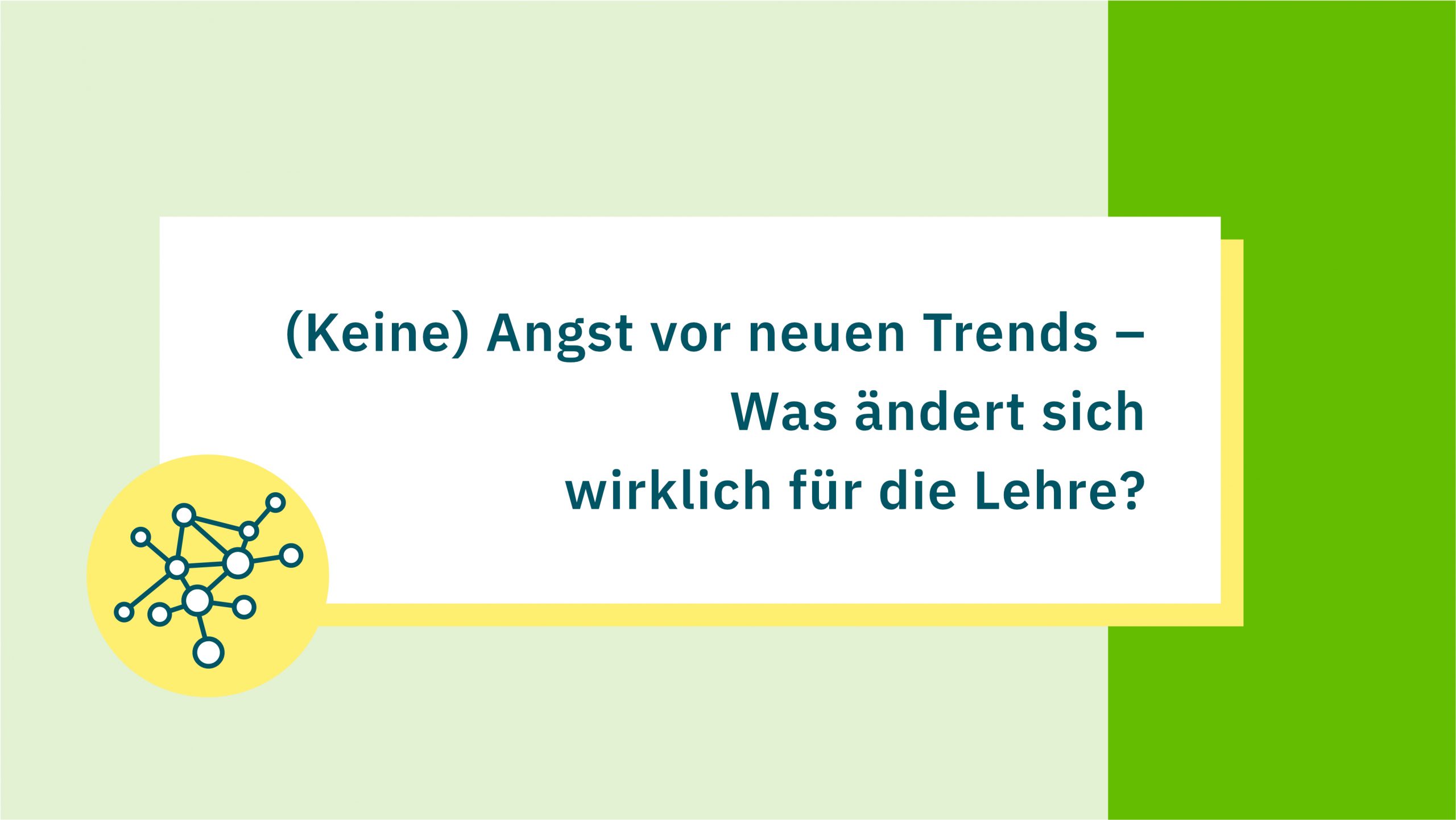Als am 9. 11. unser Beitrag zum University:Future Festival erschien und darin der Begriff „Mehrwert“ auftauchte, gab es darum eine Mini-Diskussion auf Twitter. In der Tat geistert die Forderung nach dem Mehrwert digital gestützter Lehr-Lernszenarien seit Jahren durch die Diskussionen, nicht zuletzt während der Pandemie. Schließlich muss es sich schon lohnen, diese ganze Arbeit zu investieren, die in die Umsetzung von digitalen Szenarien fließt. Am besten ist es dabei natürlich, wenn sich die Lernerfolge signifikant verbessern. Alternativ geht es natürlich auch, dass ein Mehraufwand am Anfang bedeutet, dass man später Zeit sparen kann.
Bitte nicht falsch verstehen: Mir ist sehr wohl bewusst, dass die Erstellung von Materialien Zeit und Nerven kostet, die viele Lehrende gerne an anderer Stelle nutzen würden. Kein Werkzeug und keine Plattform, sprich: kein digitales Lehr-Lernszenario, ist ohne Fehler oder so gebrauchstauglich, dass Lehrende es sofort intuitiv nutzen können. Manche sind leichter, andere komplizierter. Ohne Reibungsverluste geht es (fast) nie. Allerdings greift das Mehrwert-Argument insofern zu kurz, als dass es sich auf die Gegenüberstellung von traditionellen, analogen und neuen, digitalen Lehr-Lernszenarien bezieht. Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass eine Rechnung aufgestellt werden kann: Traditionell + Technik = Digital. In dieser Rechnung wäre die Technik tatsächlich nur eine Beigabe bei didaktischen Entscheidungen, die eigentlich aber die gleichen bleiben.
Didaktik ohne Technik? Geht nicht!
Schaut man aber genauer hin, dann sind didaktische Entscheidungen immer mit technischen Entscheidungen verknüpft, egal ob es sich um „analoges“ oder „digitales“ Lehren handelt. Das Lehren medial vermittelt ist, ist eine banale Feststellung. Sei es das Lehrbuch, der Studienbrief oder eine adaptive Online-Lernumgebung: Alle diese Medien und auch alle weiteren Vermittlungsmethoden sind Techniken. Ich muss mir als Lehrender genau überlegen, welche Mittel ich zur Vermittlung von Inhalten nutzen möchte. Dass ich dabei über den Tafelanschrieb mit Kreide kürzer nachdenken muss, bedeutet nicht, dass es nicht auch bei der Tafel zu technischen Problemen kommen kann. Sie lachen jetzt und finden das zu trivial? Wir sprechen aber nicht umsonst von Kulturtechniken. Lesen, Schreiben und Rechnen gehören genauso dazu wie die Beherrschung von Computersystemen. Dass wir bei manchen versierter sind, weil wir sie von Kindheit an erlernt haben, bedeutet nicht, dass sie nicht ebenso Einfluss auf didaktische Entscheidungen hätten.
Für Axel Krommer ist die Forderung nach dem Mehrwert, den digitale Szenarien gegenüber traditionellen haben sollten, ein Ausdruck von Kulturblindheit (siehe sein Blog-Artikel). Vielleicht muss man nicht ganz so weit gehen. Auf jeden Fall soll die vorangegangene Argumentation darauf hinweisen, dass didaktische Entscheidungen nie unabhängig von technischen Entscheidungen sind. Sicherlich steht ganz am Anfang des didaktischen Planens die Frage danach, was ich vermitteln möchte. Die Antworten auf die Fragen wie und womit ich es vermitteln möchte, können aber schnell einen Einfluss auf die Planungen haben und auch das „Was“ beeinflussen. Diese Argumentation lässt sich auch bei der gestaltungsorientierten Mediendidaktik nach Kerres und De Witt finden.
Ein Beispiel dafür, wie Technik didaktische Entscheidungen beeinflussen kann, ist die Entstehung von interaktiven, kollaborativen Whiteboards wie Miro, Mural oder Conceptboard. Ohne diese Werkzeuge können Gruppenarbeiten nur mit Umwegen einigermaßen gut unterstützt werden. In der analogen Welt gab es Pinnwände und Post-Its. Mit Stiften konnten – einmalig, wenn es sich um nicht radierbare Stifte handelte – Beziehungen visualisiert werden. Das klappte schon ziemlich gut. Adobe Connect integrierte als erstes Videokonferenzsystem ein Whiteboard, dessen Funktionalität aber recht eingeschränkt ist. Erst die oben genannten Werkzeuge bieten eine solche Funktionsvielfalt, dass kreative Erarbeitungsprozesse in der Lehre gut unterstützt werden können. Wenn Lehrende also eine Lehrveranstaltung planen und dabei auf diese Werkzeuge zugreifen können, sehen ihre Entscheidungen zur Inhaltsvermittlung durch sie selbst und zur Inhaltserschließung durch die Lernenden ganz anders aus.
Kreativität durch Einschränkung
Dazu müssen aber noch ein paar Gedanken ergänzt werden. Zum einen haben natürlich auch noch weitere Faktoren wie die Zielgruppe und die Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Entscheidungen. Auch die Befähigung, ein Werkzeug nutzen zu können, gehört dazu. Vor dem Dilemma, dass bestimmte Szenarien nicht durchgeführt werden konnten, weil die Prüfungsordnung oder nicht vorhandene Systeme oder Werkzeuge einen Strich durch die Rechnung machen, stand darüber hinaus wahrscheinlich schon mal jede*r Lehrende an einer Hochschule. Für alle diese Einschränkungen, so nervig sie manchmal sein können, gibt es gute Erklärungen und Begründungen.
Dazu ein kurzer Exkurs: Fehlende Tools, die genau das unterstützen, was Lehrende in ihren Lehrveranstaltungen planen, sind nicht im Unwillen oder gar der Böswilligkeit derer begründet, die sagen „Das geht leider nicht.“ Systeme, die sich an einer Hochschule etabliert haben, haben einen lange Einführungsprozess hinter sich, bei der die Infrastruktur, der Datenschutz, die IT-Sicherheit und die Supportstrukturen sichergestellt werden. Lehrende können sich also darauf verlassen, dass der Einsatz in der Lehrveranstaltung stattfinden kann, ohne dass sie sich um diese Themen Gedanken machen müssen. Dazu sind vorher viele knifflige Details geprüft worden. Das dauert leider.
Zurück zum Hauptgedankengang: Diese Einschränkungen können nicht nur als nerviges Hindernis gesehen werden, das Lehrende davon abhalten, das volle Potential der didaktischen Möglichkeiten zu entfalten. Im Gegenteil: Sie können als kreativitätsfördernd und als Chance gesehen werden, denn durch Einschränkungen sehen wir uns gezwungen, uns aufs Wesentliche zu fokussieren. Diese Argumentation stammt nicht (nur) von mir, sondern kann im Buch von Ralph Burckhardt „Limit Yourself. Durch Begrenzung zu mehr Kreativität“ nachgelesen werden. Er beschreibt diesen Zusammenhang zwar für den Design-Bereich, aber ich hoffe, dass niemand ernsthaft in Zweifel zieht, dass Lehre (und im Übrigen auch Lernen) im Kern etwas mit Kreativität zu tun hat. Wenn wir Lehre mit einer Leinwand vergleichen und dann überlegen, was Künstler*innen im Laufe der Jahrhunderte schon mit den Beschränkungen einer 50*70 cm großen Leinwand angestellt haben, dann wird uns beim Nachdenken über didaktische Kreativität nicht bange.
Versuchen wir also, die Technik mit all ihren Einschränkungen zu umarmen, um durch mehr Kreativität zu besseren didaktischen Entscheidungen zu kommen.